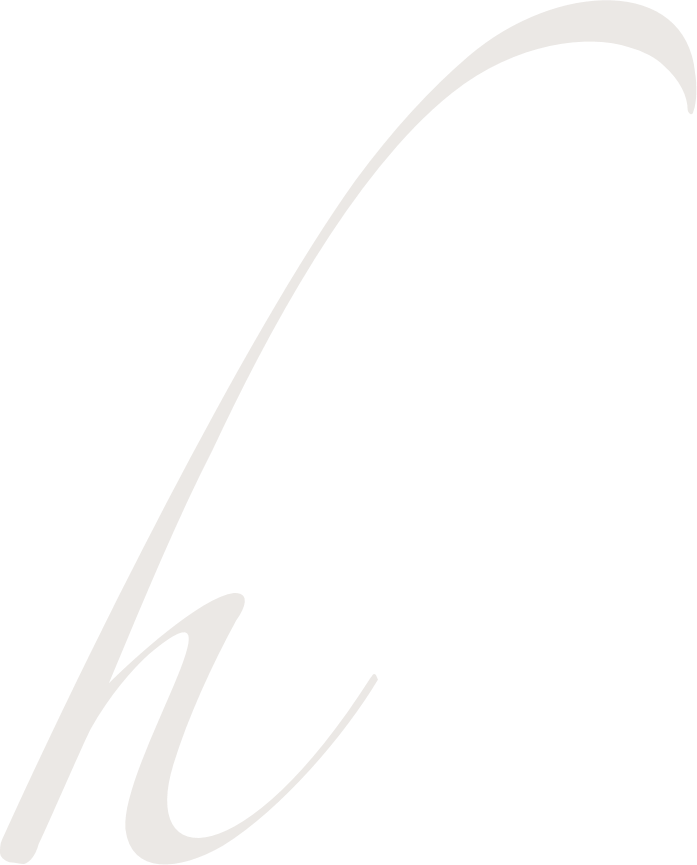Weiterwursteln, bis es wieder knallt?
Lange vor ihrem Untergang signalisierte der Markt, dass Credit Suisse zu wenig Eigenkapital hat. Ihre künftige Besitzerin UBS hat in dieser Hinsicht erheblichen Handlungsbedarf.
Credit Suisse verfügte Ende 2022 über ein ausgewiesenes Eigenkapital von 45 Mrd. Fr. und erfüllte damit die regulatorischen Anforderungen bei weitem. Die gewichtete Eigenkapitalquote betrug 14,1% der Bilanzsumme, während die harte, ungewichtete Quote 5,4% erreichte - gesetzlich erforderlich sind 3,5%. Beruft man sich auf Bundesrat, Finanzmarktaufsicht, Schweizerische Nationalbank und Bankenvertreter, sei CS einzig wegen mangelnder Liquidität kollabiert, während die Kapitalausstattung bis zuletzt komfortabel gewesen sei. Wer einzig auf die regulatorischen Messgrössen abstützt, mag das glauben. Wer jedoch den Puls der Märkte fühlt, realisierte spätestens im Herbst 2022, dass CS zu wenig Eigenkapital hatte.
Nach missglückter Ankündigung der neuen Strategie fielen die CS-Aktien im November 2022 erstmals unter 3 Fr. Die Investoren hatten ihr Vertrauen in die Bank verloren. Trotz Kapitalerhöhung erreichte die Börsenkapitalisierung kaum mehr 11 Mrd. Fr., was gerade noch einem Viertel des Eigenkapitals respektive des Buchwerts entsprach. Damit signalisierte die Börse, die von Zukunftserwartungen getrieben ist, ihr tiefes Misstrauen in die Strategie von CS.
Der anhaltende Sturzflug der CS-Aktien eskomptierte das gesicherte Wissen der Anleger, dass künftig vom Management bereits angekündigte Milliardenverluste das Eigenkapital der Bank weiter belasten werden. Die Zeichen des Marktes und explodierender Kreditausfallprämien (CDS) waren überdeutlich: Liebe Credit Suisse, wenn du weitere Milliardenverluste in Aussicht stellst, brauchst du viel mehr Eigenkapital, um sie überstehen zu können.
Liquiditätsnot war nur der letzte Akt
Der Markt hat die vermeintlich komfortable Eigenkapitaldecke von Credit Suisse schon Monate vor ihrem Untergang mit grosser Skepsis beurteilt, weshalb besonders reiche Kunden ihr Geld aus Sorge um die Solvabilität der Bank sukzessive abzogen. Der Liquiditätsengpass kam definitiv nicht aus heiterem Himmel und war nur noch der letzte Akt des Dramas. Wenn das Vertrauen von Kunden und Investoren über Monate und Jahre erodiert, kippt aber das System, wenn die Herde einmal zum Ausgang rennt, fast über Nacht, und ein Bank Run setzt ein.
Dass die AT1 Bonds von CS bereits seit vergangenem Herbst mit massivem Abschlag gehandelt wurden, verstärkt die Erkenntnis, dass der Markt schon lange an der Werthaltigkeit des Eigenkapitals zweifelte. Mit der Wertloserklärung dieser Bonds stärkte die Finma denn auch nicht etwa die Liquidität, sondern einzig das Eigenkapital der Bank - ein klares Indiz, dass CS entgegen den etwas ungeschickten Verlautbarungen von Bundesrat, Finma und SNB ein virulentes Kapitalproblem hatte.
Durch die Notübernahme von CS profitiert UBS von der Wertloserklärung von AT1 Bonds in Höhe von 16 Mrd. Fr. und erhält regulatorisches Eigenkapital von gesamthaft rund 60 Mrd. Fr. Wäre diese Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit als werthaltig zu betrachten, so wäre CS wohl schon längst übernommen worden. Zumindest hätte UBS mit dem Kaufpreis von 3 Mrd. Fr. ein gewaltiges Schnäppchen gemacht, und ihr Aktienkurs wäre nach dem Deal explodiert. Das ist nicht passiert, was die Zweifel an der Werthaltigkeit des CS-Eigenkapitals bekräftigt.
Weiter verlangt UBS vom Bund eine Verlustgarantie von 9 Mrd. Fr. für den Fall, dass ihr nach Vollzug der Übernahme von CS ein Verlust von mehr als 5 Mrd. Fr. entsteht. Warum verlangt UBS vom Bund diese Verlustgarantie, wo doch gegen 60 Mrd. Fr. verlustabsorbierendes Kapital in Credit Suisse stecken? Offenbar zweifeln selbst die Banker an der Werthaltigkeit dieser Eigenmittel.
Die Jagd nach hoher Eigenkapitalrendite, die naturgemäss umso höher ausfällt, je niedriger das Eigenkapital ist, fördert einen immanenten Interessenkonflikt der auf ihre Bonustöpfe schielenden Spitzenkader. Das Resultat ist ein brandgefährlicher Moral Hazard bei systemrelevanten Banken, die über eine faktische Staatsgarantie verfügen - zum Schaden der Steuerzahler, die als Lender of Last Resort fungieren. Es fragt sich: Wie viele Pleiten braucht es noch, bis endlich die Lehren gezogen werden?
Auch nach zwei monumentalen Schweizer Bankpleiten warnt der alte und neue UBS-Kapitän Sergio Ermotti medienwirksam vor verschärften regulatorischen Auflagen und höheren Eigenkapitalanforderungen. So hätten weder mehr Kapital noch höhere Liquidität CS vor dem Untergang bewahrt. Also munter weiter, als ob nichts geschehen wäre? Nein! Ermottis Leitspruch «Lieber too big to fail als too small to survive» ist als Weckruf zu verstehen.
Wie wir spätestens seit der Finanzkrise notabene am Beispiel von UBS wissen, haben Banken Mühe, ihre Risiken zu messen und zu beurteilen. Wenn sie trotz vermeintlich hoher Eigenkapitalquoten untergehen, sind Zweifel an ihren komplexen Modellen angebracht. Sie funktionieren bei Sonnenschein. Spätestens wenn ein Gewitter aufzieht, versagen sie. Dabei gilt es zu bedenken, dass der Untergang von Credit Suisse nicht etwa in einer weltweiten Finanzkrise, sondern «nur» in unruhigem Umfeld geschehen ist. Deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder kracht.
Für hartes Eigenkapital von 20%
Auch eine schlagkräftigere Finma wird in Zukunft überfordert sein, alle Schlaumeiereien gerissener Banker frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Um Krisen, Fehlspekulationen, Klagen sowie Bussen überstehen und im Sinne der TBTF-Regel abgewickelt werden zu können, ohne eine globale Finanzkrise auszulösen, braucht UBS viel mehr hartes Eigenkapital. Statt weniger als 5%, wie das heute der Fall ist, bedarf sie 20% - nichts anderes verlangen Banken von ihren Kunden, wenn sie einen Kredit beantragen. Wenn UBS das nicht mag, wird sie sich aufspalten, sodass sich jede Diskussion über ein kompliziertes und kaum praktikables Trennbankensystem erübrigt.
Eine harte Eigenmittelquote von 20% erhöht die Solvabilität und reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Bank Run drastisch. Tritt er trotzdem ein, so könnte UBS, und das ist der entscheidende Punkt, nur ohne Schaden für die Steuerzahler abgewickelt werden, wenn genug Eigenkapital vorhanden ist - denn der Verkaufserlös ihrer Aktiven stünde bei einer Liquidation naturgemäss unter erheblichem Druck.
Das von der Boulevardpresse vorgetragene Argument, die Forderung nach einer harten Eigenkapitalquote von 20% würde die Zinsen für Hypotheken 50% erhöhen, ist reiner Populismus (Anmerkung: Der Vizepräsident von UBS, Lukas Gähwiler, sitzt im Verwaltungsrat von Ringier). Das Gegenteil trifft zu. Je sicherer und stabiler eine Bank, desto niedriger sind ihre Kapital- und Refinanzierungskosten, sodass sie Hypotheken kompetitiver vergeben kann. Wäre dem nicht so, wären Kantonalbanken mit hoher Eigenkapitaldecke längst untergegangen.
Die Bankenindustrie ist wohl die einzige Branche, die proklamiert, ihr Erfolg sei nur mit niedrigen Eigenkapitalquoten möglich - um dann regelmässig in die nächste Krise zu schlittern. Das ist irritierend und inakzeptabel. Eine Whatever-it-takes-Politik, die den Moral Hazard weiter befeuert, würde die Schweiz im Fall des Untergangs von UBS definitiv überfordern. Gibt es eine Alternative zu markant erhöhten Eigenkapitalerfordernissen? Ja, diese: Weiterwursteln wie bisher und einige Jahre warten, bis es wieder «chlöpft» - in der schieren Grösse der Giganten-UBS dann wenigstens zum letzten Mal.
Dr. Pirmin Hotz
ist Gründer und Inhaber der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG mit Sitz in Baar
- Interessenkonflikte
- Langfristig
- Renditeberechnung