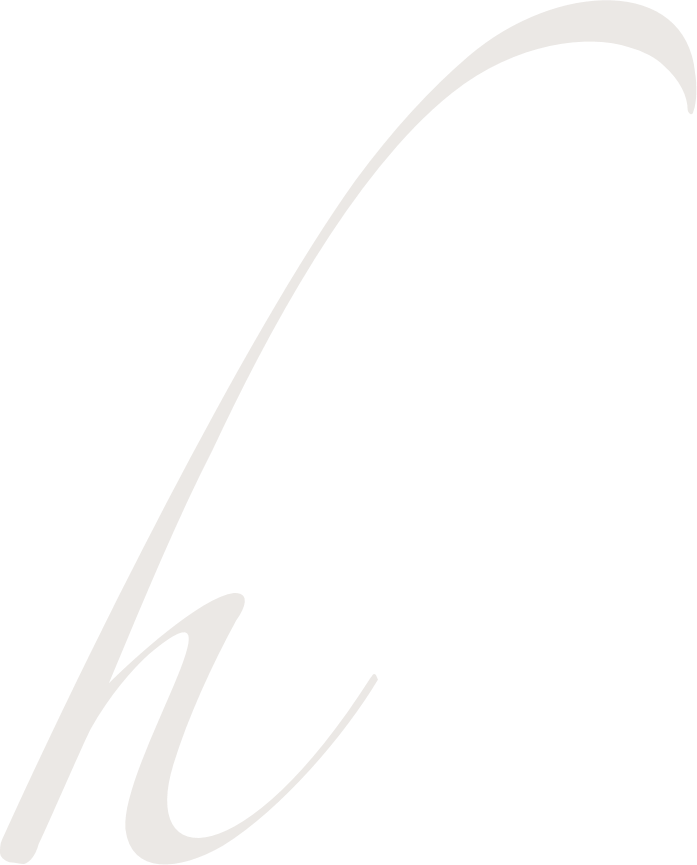Aktien von Banken für Zocker
Investoren können auf Valoren von Grossbanken getrost verzichten. Die Anlagerisiken sind zu hoch und die langfristige Performance schwach. Das wird sich in Zukunft kaum ändern.
Weniger als ein Jahr nach dem unrühmlichen Untergang von Credit Suisse produzierte mit Julius Bär eine weitere international angesehene Schweizer Bank Negativschlagzeilen. Die Verantwortlichen haben sich mit mutmasslich blauäugigen Krediten an das intransparente Unternehmenskonstrukt des gescheiterten österreichischen Immobilienmoguls René Benko verzockt.
Es erstaunt nicht, dass das ramponierte Vertrauen der Investoren zum Abgang des Chefs von Julius Bär geführt hat. Immerhin stehen im Kontrast zu Credit Suisse die Chancen gut, dass der damit einhergehende Aktienkursrückschlag temporärer Natur war und die Verantwortlichen die entsprechenden Lehren ziehen werden.
Aus Anlegersicht stellt sich die Frage, ob Aktien von Banken überhaupt eine Berechtigung in einem Wertschriftenportfolio haben. Seit Jahrzehnten gibt die Branche immer wieder Anlass zu Kritik. Wir erinnern uns: In der Finanzkrise von 2008 musste UBS vom Staat gerettet werden, weil sie sich mit vermeintlich sicheren Finanzprodukten im Subprime-Sumpf verspekulierte.
Seither belasteten zahlreiche Skandale die Bankenwelt. Beispielhaft seien die Geldwäscherei- und Korruptionsfälle rund um die Fifa, den brasilianischen Ölkonzern Petrobras, den malaysischen Staatsfonds 1MDB, den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA oder die abenteuerliche Thunfisch-Saga in Mosambik erwähnt. Dazu kommen Milliardenverluste aus waghalsigen Geschäften mit Archegos und Lex Greensill, die die Reputation der involvierten Banken schwer beschädigt haben.
Dass trotz all dieser Vorfälle die Bankkader zu den bestverdienenden Managern der Wirtschaft gehören, ist zumindest fragwürdig. So beschäftigte Credit Suisse offenbar über tausend sogenannte Key Risk Takers, die ein Millionensalär kassierten. Die hohe Zahl ist absurd, zumal die wahren Risiken nicht vom Management, sondern vielmehr von den Aktionären getragen werden.
Scheinargumente bei Gehältern
Es fehlt den verantwortlichen Managern am Willen zum Masshalten. Das gebetsmühlenartig vorgetragene Argument, die hohen Gehälter seien nötig, um die besten Talente rekrutieren zu können, ist ein Scheinargument, das auch mit seiner ständigen Wiederholung nicht zu überzeugen vermag. Banken brauchen solide Schaffer an der Spitze, keine Übermenschen. Für Aktionäre europäischer Grossbanken besonders ernüchternd ist die Tatsache, dass im Zuge all dieser Skandale buchhalterische «Sonderfaktoren» und toxische Altlasten zum Regelfall geworden sind. Nichtsdestotrotz tritt jede Managergeneration ihre Aufgabe mit dem Versprechen an, die Altlasten der Vorgänger zu beseitigen und eine neue Kultur zu schaffen. Es wird Besserung gelobt, um bald darauf neuerlich vom Geist der Vergangenheit eingeholt zu werden. Aus Sicht des Aktionärs stellen sich zwei Fragen. Erstens: Entspricht das Geschäftsmodell der Banken in qualitativer Hinsicht meinen Ansprüchen? Nimmt man UBS als letzte verbliebene Schweizer Grossbank als Massstab, so besteht Hoffnung. Die Führungscrew mit Colm Kelleher und Sergio Ermotti zeigt sich entschlossen, die Bank in eine solide und erfolgversprechende Zukunft zu navigieren. Allerdings werden sie und ihre Nachfolger erst noch beweisen müssen, dass sie die Interessen der Aktionäre dauerhaft in den Fokus stellen.
In fünf oder zehn Jahren werden wir mehr wissen. Bis dann muss auch das Reservepolster von UBS, das heute mit weniger als 5% hartem Eigenkapital viel zu dünn ist, um schwere Krisen ohne staatliche Stützungsmassnahmen überstehen zu können, markant aufgestockt werden. Sergio Ermotti wäre auch gut beraten, sich von seinem Ziel zu verabschieden, bis 2028 eine Kapitalrendite von 18% zu erwirtschaften. Eine hohe Rendite auf viel zu niedrigem Eigenkapital setzt, wie die Vergangenheit gelehrt hat, gefährliche Anreize.
Zurückhaltung ist sodann auch in der Dividendenpolitik und bei Aktienrückkäufen angezeigt. Der Weg von UBS zu neuem Glanz ist noch lang. Obwohl ihr Aktienkurs in jüngerer Vergangenheit deutlich zugelegt hat, liegt er immer noch fast zwei Drittel unter dem vor der Finanzkrise erreichten Höchstwert.
Zweitens stellt sich die Frage: Werde ich als Aktionär von Bankaktien langfristig adäquat für mein Risiko entschädigt? Ein Vergleich europäischer Banktitel mit dem Gesamtmarkt gibt Aufschluss. So hat der Subindex Stoxx Europe 600 Banks mit Referenzwährung Franken von 2014 bis 2023 eine kumulierte Rendite von -0,7% (-0,1% p.a.) abgeworfen, während der Gesamtmarkt Stoxx Europe 600 eine Rendite von kumuliert 51,8% (4,3% p.a.) erreicht.
Über eine lange Periode von zwanzig Jahren sieht es noch schlechter aus für die Geldhäuser. Bankaktien brachten es auf eine kumulierte Performance von -32,2% (-1,9% p.a.), während der Gesamtmarkt eine Rendite von insgesamt 140,4% (4,5% p.a.) realisierte. Mit Papieren von Banken schmilzt das Geld der Anleger offenbar wie Schnee an der Sonne. Besser sieht es für die Valoren von Kantonalbanken aus. Zahlreiche Beteiligungspapiere von Staatsbanken haben in der langen Frist eine Performance hingelegt, die nicht nur mit dem SPI mithalten kann, sondern auch weit über derjenigen von Grossbanken liegt. Wer sein Geld mit Banktiteln mehren möchte, ist folglich gut beraten, in Kantonal- statt in Grossbanken zu investieren.
Aufgepasst auch bei Kantonalbanken
Aus liberaler und marktwirtschaftlicher Sicht mag diese Erkenntnis frustrierend sein: Nicht etwa die Manager privater Grossbanken setzen sich für das Wohl ihrer Aktionäre ein, sondern die Vertreter von mehrheitlich in Staatsbesitz befindlichen Kantonalbanken. Aber aufgepasst: Wer glaubt, Aktien und Partizipationsscheine von Kantonalbanken seien quasi sichere «Witwen-und-Waisen-Papiere», mit denen man ruhig schlafen könne, täuscht sich.
Tatsache ist, dass vor nicht allzu langer Zeit mehrere Kantonalbanken wegen Missmanagements und fauler Hypotheken in Schieflage gerieten, mit staatlichen Mitteln saniert werden mussten oder vom Markt verschwunden sind. Es sind dies die Kantonalbanken von Appenzell Ausserrhoden, Bern, Genf, Glarus, Solothurn und Waadt. Traditionellerweise sind diese regional verankerten Banken stark im Hypothekargeschäft engagiert, weshalb ihre Entwicklung nicht zuletzt von der Immobilienentwicklung abhängt. Da die letzte grosse Immobilienkrise in der Schweiz mittlerweile dreissig Jahre zurückliegt, lässt sich schwer abschätzen, welche Schockwellen eine neuerliche Krise auslösen würde. Mit ziemlich grosser Sicherheit würden sie aber auch die Aktionäre von Kantonalbanken hart treffen.
Nicht gut genug
Gemäss den amerikanischen Professoren Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff («Dieses Mal ist alles anders - acht Jahrhunderte Finanzkrisen») gab es seit Beginn des 19. Jahrhunderts acht Bankenkrisen in Deutschland, fünfzehn in Frankreich, zwölf in Grossbritannien und dreizehn in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit anderen Worten: Im Durchschnitt befindet sich die Bankenwelt alle zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre in einer existenziellen Krise.
Gibt es einen Grund, daran zu zweifeln, dass dies in Zukunft anders sein wird? Die Fakten sprechen dagegen. Anat Admati, Finanzprofessorin an der Stanford University, hat es einmal wie folgt auf den Punkt gebracht: «Heute spricht jeder Banker davon, was alles besser geworden ist. Aber besser im Vergleich zu sehr schlecht ist nicht gut genug.»
Dr. Pirmin Hotz
ist Gründer und Inhaber der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG mit Sitz in Baar
- Interessenkonflikte
- Langfristig