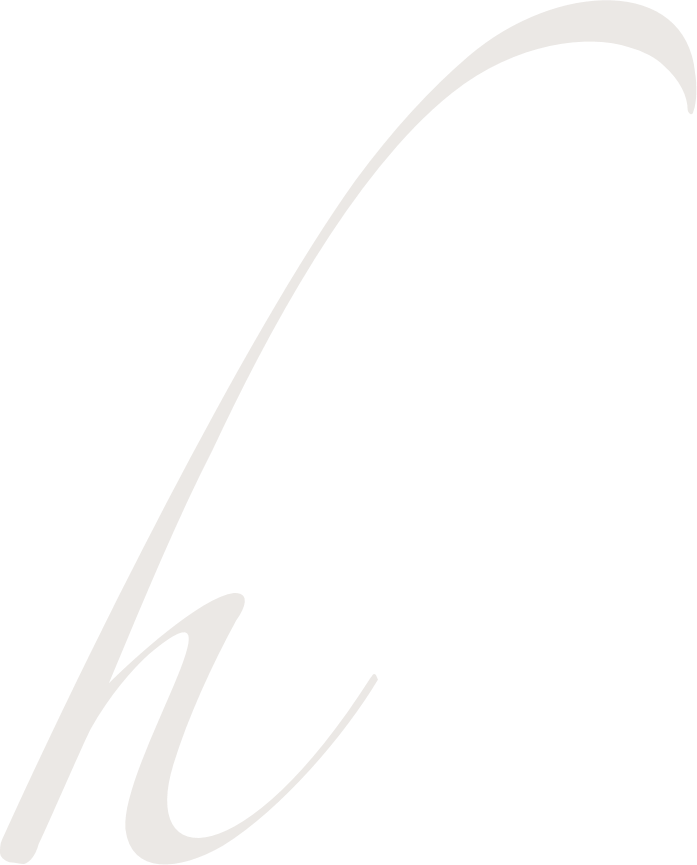Jahresendbericht 2022
«Whatever it takes» – dieser legendäre Satz, den der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, an einer Investorenkonferenz am 26. Juli 2012 kundtat, ging um die Welt und zeigte Wirkung. Die EZB war fest entschlossen, den drohenden Kollaps hoch verschuldeter Nationen wie Griechenland, Italien, Portugal und Spanien zu verhindern. In der Folge wurden die Märkte wie nie zuvor in der Geschichte mit billigem Geld geflutet, und die Zinsen fielen ins Bodenlose. Plötzlich hatte Geld keinen Wert mehr. Im Gegenteil: Wer viel Geld auf seinem Bankkonto hatte, musste sogar Negativzinsen bezahlen. Hypothekarschuldnern wurde das Geld quasi zum Nulltarif nachgeworfen. Das Erstaunlichste an dieser gigantischen Geldflutung war, dass sämtliche Befürchtungen von Ökonomen, das billige Geld würde die Inflation gefährlich anheizen, über lange Jahre vom Winde verweht wurden. Auch wir haben in unserem halbjährlich erscheinenden Brief an unsere Kundinnen und Kunden verschiedentlich die Frage aufgeworfen, ob die Lehrbücher, die wir damals über Geld und Inflation an unseren Universitäten verschlungen haben, heute ihren Platz vorzugsweise in einem Brockenhaus haben würden.
«Sind Kredite gratis, hat das eine vergleichbare Wirkung wie Freibier: Man trinkt gerne über den Durst. Das ist ein schönes Lebensgefühl. Dumm nur, dass man es hinterher mit einem Kater büsst.»
Der Wind hat gedreht – und wie! Im Zuge jahrelanger geldpolitischer Impulse, des Kriegs in der Ukraine, der weltweiten Lieferkettenprobleme und der dramatisch verteuerten Energiepreise ist die Inflation in den Vereinigten Staaten von Amerika zwischenzeitlich auf rund 9 und in Europa sogar auf über 10 Prozent hochgeschnellt – in Deutschland lag die Teuerung so hoch wie seit 70 Jahren nicht mehr. Dies hat die Notenbanken, deren eigentlicher Auftrag die Verfolgung der Geldwertstabilität ist, zum Handeln veranlasst. Primär war es das amerikanische Fed, das unter Führung seines Präsidenten Jerome Powell die Leitzinsen in mehreren Schritten anhob, um das Inflationsgespenst entschlossen zu bekämpfen. In seiner Rede vom 21. September 2021 zitierte Powell den legendären Fed-Chef Paul Volcker, der Ende der 1970er-Jahre die Leitzinsen aufgrund einer ausufernden Inflation, die damals über die Marke von 14 Prozent stieg, ebenfalls drastisch erhöhen musste. Mehrmals referenzierte er die Worte «we will keep at it» (wir werden dranbleiben) und lehnte sich damit an die 2018 erschienene Biografie von Paul Volcker mit dem Titel «Keeping at it» an.
«Inflation ist eine Art Steuer, die nicht vom Gesetzgeber genehmigt werden muss.»
Massiv steigende Inflationsraten, die wiederum von stark steigenden Zinsen begleitet sind, und weltweite Rezessionstendenzen haben im abgelaufenen Jahr sowohl die Anleihen- und Aktienmärkte als auch Immobilienfonds sowie Immobilienaktien erheblich belastet. Wir erleben zurzeit den grössten Anleihen-Crash seit Jahrzehnten. Gemäss der Online-Zeitung «The Market», die sich auf eine Analyse der Bank of America abstützt, ist 2022 das viertschlimmste Jahr in der Geschichte der Staatsanleihen. Nur gerade die Verluste in den Jahren 1721 (Platzen der Südseeblase), 1865 (Ende des Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten von Amerika) und 1920 (Ende des Ersten Weltkriegs) waren heftiger. Ein Grossteil der Investorinnen und Investoren erleidet Verluste von 10 bis 20 Prozent auf seinen festverzinslichen Anleihen – oft mehr, als dies bei den Aktien der Fall ist. Um dies zu illustrieren, sei das Beispiel der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erwähnt. Sie verfügte zu Beginn des Jahres 2021 über einen Anlagebestand von rund CHF 950 Mrd., von denen gegen drei Viertel in Anleihen und «nur» ein Viertel in Aktien investiert war. Mit diesem vermeintlich konservativen Risikoprofil erlitt die SNB alleine in den ersten neun Monaten des Jahres einen historischen Rekordverlust von CHF 142 Mrd. – das entspricht einer Performance von rund –15 Prozent. Mit einem reinen Aktienportfolio wäre die Performance kaum schlechter ausgefallen. Weil die SNB ihre Gelder weitgehend passiv respektive indexiert investiert, weist ihr Obligationenportfolio teilweise extrem lange Laufzeiten auf – mit den entsprechenden Folgen bei einem markanten Anstieg der Zinsen. Das vermeintlich risikoaverse, von Obligationen dominierte Portfolio der SNB entpuppt sich in der aktuellen Baisse als alles andere denn konservativ. Genauso wie die Nationalbank haben viele Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Vermögensverwalter im Zuge nicht mehr vorhandener Zinsen die Laufzeiten ihrer Obligationen massiv erhöht und deren Qualität verschlechtert, um doch noch einen positiven Zins zu erhaschen. Sie erhalten nun in brutaler Weise ihre Quittung. So hat beispielsweise die 100-jährige österreichische Staatsanleihe über 60 Prozent ihres einstigen Höchststandes eingebüsst.
Es hat sich im Jahr 2022 ausbezahlt, festverzinsliches Geld konservativ anzulegen. Weil die Zinssätze von Problemländern wie Griechenland und Italien überdurchschnittlich angezogen haben und wieder deutlich über denjenigen von Deutschland oder Frankreich liegen, haben die entsprechenden Anleihenkurse heftig korrigiert. Das gilt genauso für Schwellenmarkt- und Unternehmensanleihen mit eingeschränkter Bonität (Junk Bonds). Wie fragil die Märkte inzwischen auf Unsicherheit reagieren, musste die Regierungschefin Grossbritanniens mit der historisch kürzesten Amtszeit, Liz Truss, in einem Politdrama bitter erfahren. Ihre planlose Ankündigung, ein Steuersenkungsprogramm in der Höhe von GBP 45 Mrd. umzusetzen, löste einen erdbebenartigen Zinsanstieg am britischen Anleihenmarkt aus und brachte viele Pensionskassen in existenzielle Schwierigkeiten, sodass die englische Notenbank mit Interventionen unterstützend eingreifen musste.
Das Jahr 2022 war bezüglich aller Anlagekategorien herausfordernd. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt und mit unseren Wettbewerbern stehen wir allerdings wesentlich besser da. Im relativen Performance-Vergleich ist es eines der erfolgreichsten Jahre unserer Firmengeschichte. Das liegt im festverzinslichen Segment daran, dass wir rigoros auf Qualität und den Fokus auf kurz- und mittelfristige Anleihen setzen, weshalb sich die Verluste unserer Obligationen in engen Grenzen halten. Bei den Aktien profitieren wir von unserem wertorientierten Ansatz respektive davon, dass sich unser Anteil an hoch bewerteten Technologietiteln in überschaubarem Rahmen hält – so hat der Index der Technologiebörse Nasdaq seit seinem Höchststand im November 2021 zwischenzeitlich über einen Drittel seines Wertes verloren. Dazu kommt, dass wir antizyklisch an soliden Unternehmen des Rohstoffsektors festgehalten haben und unser Anteil heissgelaufener Small & Mid Caps, die im abgelaufenen Jahr regelrecht zerzaust wurden, vergleichsweise gering ist.
Wer hätte diese negative Marktentwicklung erwartet? Dr. Burkhard Varnholt, Chief Investment Officer der Credit Suisse, verkündete im Dezember 2021, die Zinsen würden noch lange tief bleiben und die amerikanische Notenbank Fed würde erst im vierten Quartal 2022 ihre Leitzinsen erhöhen, und zwar um 0,25 Prozent. Die Wahrheit sah dann so aus: Von März bis Mitte Dezember 2022 wurden die amerikanischen Leitzinsen in grossen Schritten von 0,25 auf satte 4,5 Prozent erhöht. Auch bezüglich der Aktienmarktprognose für das Aktienjahr 2022 hat sich der Experte getäuscht. Im Januar 2022 schrieb Varnholt in der Zeitschrift «Schweizer Personalvorsorge», die sich an Pensionskassenverantwortliche richtet, zum Ausblick 2022: «Wir erwarten von globalen Aktien im kommenden Jahr eine solide, einstellige Jahresperformance.» So prognostizierte er zum Jahresende einen SMI-Stand von 13'245. Ende 2021 lag der SMI bei 12'876, am 15. Dezember 2022 bei 11’161 Punkten. Alleine die Präzision seiner Voraussage ist erstaunlich – 13'245 Punkte! Erstaunlich ist überdies, was Burkhard Varnholt die Leserschaft der «Finanz und Wirtschaft» noch am 25. August 2021 wissen liess: «Man muss davon ausgehen, es nicht besser als der Markt zu wissen. Das ist schon einmal ein guter Startpunkt … denn die Märkte sind vor allem sehr effizient.» Nanu, was gilt denn jetzt? Die Prognostizierbarkeit der Märkte (auf 5 Punkte genau) oder vielmehr deren Effizienz, die gleichzusetzen ist mit einer kurz- und mittelfristigen Nicht-Prognostizierbarkeit?
«Wenn sich alle Experten in den Prognosen einig sind, wird etwas anderes passieren.»
Burkhard Varnholt war zu Beginn des Jahres lange nicht der Einzige, der positiv für die Märkte gestimmt war. Dr. Daniel Kalt, Chefökonom und Regional Chief Investment Officer Schweiz der UBS, prognostizierte für 2022 ebenfalls klar positive Renditen für den Schweizer Aktienmarkt und erwartete einen SMI-Stand von 13'700. Übertroffen wurde seine Prognose sogar noch von Anastassios Frangulidis, Leiter Multi Asset Zürich der Privatbank Pictet. Er sah den SMI auf 14'000 Punkte steigen. Christian Gattiker, medial bekannter Head of Research bei der Bank Julius Bär, meldete sich in der «Finanz und Wirtschaft» vom 5. Juni 2021 wie folgt zu Wort: «Rekorde sind ein Ausdruck dafür, dass der Bann gebrochen ist … Das deutet auf einen mehrjährigen Aufwärtstrend hin.» In der Online-Zeitung «The Market» doppelte er am 18. Juni desselben Jahres nach: «Ob SMI oder Kurs-DAX: Rund zwanzig Jahre gedeckelt, wird hier die Hausse erst angepfiffen.» Auch die Leserinnen und Leser der Online-Zeitung «Cash» liess er am 9. Juli wissen: «In der Schweiz und in Europa sind wir gerade erst am Anfang einer Aktien-Hausse.»
Dr. Maurice Pedergnana, Lehrbeauftragter für Banking und Finance an der Hochschule Luzern und Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ), schrieb am 2. Juni 2022 in einer Kolumne der «Zuger Zeitung»: «’Sell in May and go away’ wäre gewiss ein schlechter Ratschlag. Man dürfte die schönste Investitionsperiode des gesamten Jahres verpassen.» Pedergnana erwartete einen erfreulichen Börsensommer. Das Gegenteil ist eingetroffen: Kurz nach Erscheinen seiner Kolumne mündete der Aktienmarkt in eine hartnäckige Sommer-Baisse. Mit derartigen Prognosen ist es wie im Casino: Die Kugel fällt (einmal abgesehen von der Null) mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent auf «schwarz» oder «rot». Immerhin: Die Prognosegläubigen brauchen sich nicht zu schämen. Auch die Wall-Street-Ikonen von Goldman Sachs erwarteten per Ende 2022 einen S&P-500-Indexstand von 5'100 Punkten respektive eine Performance von 10 Prozent – und liegen damit meilenweit neben der Realität. Per 15. Dezember lag der S&P 500 bei 3'995 Punkten. Was lernen wir daraus? Bezüglich ihrer Prognosefähigkeiten glauben einige Experten, sie könnten über Wasser gehen. In der Baisse können viele dann aber oft nicht einmal schwimmen. Gurus, die Marktentwicklungen vorhersagen, sollte man etwa so stark vertrauen, wie wenn Meteo-Chef Thomas Bucheli zum Jahresanfang das Wetter für den Schweizer Nationalfeiertag am 1. August prognostizieren würde. Kurz- und mittelfristige Prognosen von Analysten und Gurus sind für den Schredder.
«Wer heute den Propheten spielt, ist ein Narr.»
Positive Ausblicke auf die Aktienmärkte sind Schnee von gestern. Hört man sich im aktuellen Umfeld um, so fällt auf, dass die Zahl der Propheten, die auf zwischenzeitlich massiv tieferem Niveau weiter sinkende Märkte erwarten, zugenommen hat. Sie verdrängen zunehmend die Optimisten und haben gute Gründe für ihre These: Wichtige Weltregionen stecken in einer Rezession, die Inflation ist hartnäckig hoch, und der Krieg in der Ukraine belastet. China wiederum ist ein weltpolitisches Pulverfass, das ebenfalls in einer wirtschaftlichen Krise steckt. Dazu kommt, dass die Konjunktur stockt und die Gewinne einiger Unternehmen enttäuschend ausfallen werden. Es gibt also gute Gründe, die Finger von Aktien zu lassen. Wer nun aber glaubt, die aktuelle Konjunktur oder auch die unmittelbaren Konjunkturaussichten seien ein verlässlicher Indikator, um die Börsenentwicklung vorherzusagen, irrt. Erwin Heri, Finanzprofessor der Universität Basel, hat in seinem Fintool-Video-Beitrag vom 9. August 2022 aufgezeigt, dass die Korrelation (ein Mass, das die gegenseitige Abhängigkeit beschreibt) zwischen der amerikanischen Konjunkturentwicklung (in Form des Bruttoinlandprodukts BIP) und der Börsenentwicklung des S&P 500 in der Zeitperiode von 1980 bis 2021 gerade einmal bei 0,04 lag. Mit anderen Worten: Es gibt so gut wie keinen direkten Zusammenhang zwischen der Konjunktur- und der Börsenentwicklung. Deutlich wurde dies im Corona-Jahr 2020: Die starke Börsenentwicklung des S&P 500 von 16,3 Prozent kontrastierte mit dem BIP, das im selben Jahr um 4 Prozent schrumpfte. Warum ist das so? Ganz einfach: Die Märkte reagieren unglaublich effizient respektive rasch auf neue Informationen – so erreichen die Börsen ihren Tiefpunkt oft viele Monate, bevor die Konjunktur ihren Tiefpunkt erreicht und sich zu erholen beginnt. Weil die Börse von Erwartungen lebt, steigen Aktien längst, bevor sich die Konjunktur erholt. Düstere Erwartungen zu Politik und Wirtschaft reflektieren sich, so schlecht sie auch sein mögen, längst in tieferen Börsenkursen, bevor sie Realität werden. Wenn das Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird, steigen die Aktienkurse bereits wieder, obwohl der wirtschaftliche Tiefpunkt gar noch nicht erreicht ist. Diesen Zusammenhang zu begreifen, ist von fundamentaler Bedeutung, wenn man die Börse verstehen will.
«Der grösste Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, sondern die Illusion des Wissens.»
Haben Sie gesehen, wie der chinesische Machthaber Xi Jinping seinen Vorgänger Hu Jintao am 20. Parteikongress aus der Grossen Halle des Volkes abführen liess? Die zweiminütige Videosequenz ging im vergangenen Oktober um die Welt. Die Szene symbolisiert auf schockierende Art und Weise die zunehmende Machtkonzentration in der Parteidiktatur Chinas. Das Reich der Mitte hat sich aus unserer Sicht als potenzielles Anlageland definitiv verabschiedet. Wie Sie wissen, investieren wir prinzipiell nicht in Unternehmen, die ihren Sitz in einem nicht-demokratischen Staat haben. Wir haben das nie bereut. Die Performance des chinesischen Aktienmarkts ist seit längerer Zeit eine Katastrophe. Das hat inzwischen auch der bisher glühendste China-Fan, der legendäre amerikanische Hedge-Fund-Guru Ray Dalio, begriffen. Lange Jahre predigte er das Mantra: «Wer nicht in China investiert, ist schlecht diversifiziert.» Nun hat er einen Grossteil seiner chinesischen Aktien verscherbelt. Gar noch schlimmer sieht es mit Anleihen und Aktien aus Russland aus, die über 80 oder 90 Prozent ihres Wertes verloren haben. Westliche Anlegerinnen und Anleger sind typischerweise über sogenannte Hinterlegungsscheine respektive American Depositary Receipts (ADR) in russische Aktien investiert. Nachdem Präsident Putin die ADR-Zertifikate als Reaktion auf die Sanktionsmassnahmen des Westens per Dekret verboten hat, wurden internationale Investoren, die ihr Geld in russischen Aktien angelegt haben, faktisch enteignet. Wir bleiben dabei: Keine Direktanlagen in Willkürstaaten. Mit unseren multinationalen Unternehmen decken wir die Schwellenmärkte genügend ab.
«Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf über die nächste Mahlzeit abstimmen.»
Was würden Sie sagen, wenn wir uns von unseren über Jahre und Jahrzehnte gelebten Überzeugungen verabschieden und Ihnen plötzlich Anlagen in Hedge Funds, Junk Bonds oder Bitcoin empfehlen würden? Und dies, nachdem wir seit jeher zu den grössten Kritikern dieser Anlagen gehörten? Sie würden vermutlich die Welt nicht mehr verstehen und ungläubig den Kopf schütteln – zu recht. In der Bankenwelt gelten diesbezüglich andere Gesetze. So verkündete Jamie Dimon, der wohl bekannteste und profilierteste Banker der Welt, noch am 11. Oktober 2021 an einer Versammlung des Institute of International Finance (IIF) mit grosser Überzeugung, dass Bitcoin ein «Betrug» sei und «in die Luft fliegen» würde. Wenn Trader von JPMorgan Chase mit der Kryptowährung handeln würden, «würde ich sie sofort feuern, und zwar aus zwei Gründen: Es ist gegen unsere Regeln, und diese Trader sind dumm – beides ist gefährlich.» Der langjährige Chef der amerikanischen Grossbank argumentierte, Kryptowährungen seien kein valables Geschäftsmodell, weil Leute eine Währung aus dem Nichts erfänden. «Ehrlich gesagt, ich bin einfach schockiert, dass niemand sieht, was es ist», schob Jamie Dimon nach. Zur Grandesse der Finanzwelt gehört auch Larry Fink, Gründer und Chef von BlackRock, dem grössten Vermögensverwalter der Welt. «Bitcoin zeigt, wie gross die Nachfrage nach Geldwäsche in der Welt ist … mehr ist es nicht», polterte Fink noch vor ein paar Jahren. Bitcoin sei nichts anderes als ein Geldwäscherei-Index.
«Ich persönlich denke, dass Bitcoin wertlos ist.»
Das alles ist Schnee von gestern. In einem Brief an seine Investorinnen und Investoren schrieb Larry Fink im Frühjahr 2022, «BlackRock studiert digitale Währungen und die zugrundeliegenden Technologien, um zu verstehen, wie sie uns bei der Betreuung unserer Kunden helfen können.» Ein globales und digitales Zahlungssystem könne das Risiko von Geldwäsche und Korruption verringern, erklärte Fink. Was für ein Salto rückwärts! Im Rahmen der neuen Strategie ist BlackRock in diesem Jahr eine Partnerschaft mit der Kryptowährungsplattform Coinbase eingegangen, und institutionelle Kunden können in einen Bitcoin-Trust investieren. JPMorgan Chase hat Onyx gegründet, in der alle Blockchain-Projekte der Bank angesiedelt sind – auch bei ihr sind Kryptowährungen kein Tabu mehr. Gar noch einen Schritt weiter geht Fidelity. Der viertgrösste Vermögensverwalter der Welt bietet seinen Anlegern in Zukunft die Möglichkeit, Kryptowährungen in ihre Altersvorsorge aufzunehmen. Bitcoin & Co. als Altersvorsorge? Uns stehen die Haare zu Berge.
Als Anhänger des Liberalismus respektieren wir es natürlich, wenn jemand seine Meinung ändert – auch wenn es sich dabei um einflussreiche Konzernchefs handelt. Es kommt ja schliesslich vor, dass sich die Fakten ändern oder man neue Erkenntnisse gewinnt, die bisher verborgen blieben. Spannend wäre deshalb, von Jamie Dimon und Larry Fink persönlich zu erfahren, warum sie diesen 180-Grad-Schwenker vollzogen haben. Unsere Recherchen, die auf Medienberichten basieren, führen zu einem desillusionierenden Ergebnis: Die beiden Konzernchefs kippten ihre Meinung wohl nicht etwa deshalb, weil sie zu anderen Überzeugungen gelangten, sondern weil offenbar eine wachsende Zahl von Kunden ein Interesse an Bitcoin und anderen Kryptowährungen signalisiert. Diese Haltung irritiert, denn wir sind überzeugt, dass weder Jamie Dimon noch Larry Fink jemals ihr eigenes Geld in Kryptos stecken werden. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass Kundinnen und Kunden ihren Vermögensverwalter nicht zuletzt deshalb zu schätzen wissen, weil dieser ein klares Geschäftsmodell und eine klare Überzeugung lebt. Wer aber seinen Kunden (Un-)Kraut und Rübe offeriert und empfiehlt, nur weil dies von einer Schar von Mandanten nachgefragt wird, kann unmöglich ein unabhängiger sowie glaubwürdiger Gesprächspartner und Berater auf Augenhöhe sein. Anlagen und Produkte, die wir aus Überzeugung nicht für uns selber kaufen, legen wir auch unseren Kundinnen und Kunden nicht ins Körbchen – basta.
«The business of business is business.»
Selbstverständlich wollen wir offen sein für Neues und uns Innovationen gegenüber keineswegs verschliessen. Getreu dem Motto «Kaufe nur, was Du auch selber verstehst» werden wir aber auch in Zukunft an unseren Überzeugungen und Grundsätzen festhalten. So wollen wir wissen, warum wir mit einer Anlage auf lange Sicht für unsere Kunden Geld verdienen können – wir wollen das Geschäftsmodell verstehen. Dies erfordert einen kritischen und wachsamen Geist, der stets dem Wohle unserer Kundinnen und Kunden zu dienen hat. Wenn einzelne Kundinnen oder Kunden trotzdem Bitcoin oder Hedge Funds kaufen wollen, können sie das selbstverständlich jederzeit tun – aber auf eigene Verantwortung und Gefahr. Einfach Business zu kreieren, weil es Business gibt, kommt für uns aus prinzipiellen Gründen nicht in Frage.
Die Tatsache, dass zahlreiche Promis mit Pauken und Trompeten die Werbetrommel für Kryptowährungen rühren, weckt bei uns Skepsis. In TV-Spots der Handelsplattform Crypto.com bezeichnete Hollywoodstar Matt Damon die Anlage in virtuelle Währungen als «neue Entdeckungsgrenze der Menschheit». Entdeckungsgrenze im Anlagegeschäft – was genau soll denn das heissen? Schauspielerin Reese Witherspoon und Starsportler wie LeBron James und Tom Brady traten ebenfalls als Werbebotschafter für Kryptowährungen auf – notabene in einem Zeitpunkt, als die Spekulationsblase ihren Höhepunkt erreichte. Im November wurden die Stars mit Sammelklagen eingedeckt. Influencer-Stars wie Kim Kardashian kassierten Millionen, indem sie teilweise obskure Krypto-Neuschöpfungen auf ihren Social-Media-Plattformen zum nächsten grossen Wurf erklärten und ihre Follower zu einem Einstieg animierten. Der von Kardashian angepriesene Ethereum Max suggerierte eine Weiterentwicklung von Ethereum, der neben Bitcoin bekanntesten Digitalwährung. Nach kurzem Höhenflug kollabierte Ethereum Max, und Kardashian wurde mit Gerichtsklagen eingedeckt. Solche drohen auch dem berühmten Boxer Floyd Mayweather. Für seine Dienste liess er sich in harten Dollar bezahlen, während seine Fans auf wertlosen Token sitzen bleiben. Ein etwas mulmiges Gefühl erhält schliesslich auch, wer mit der U-Bahn durch die City von London rattert und in den Tunneln neben Werbung für Burger und Bonbons auf Plakate für Kryptoprodukte stösst.
«Kryptowährungen sind nichts wert, da sie auf nichts basieren. Es gibt keinen zugrundeliegenden Vermögenswert, der als Sicherheitsanker fungiert. Ich bin besorgt über Menschen, welche die Risiken nicht verstehen, alles verlieren und furchtbar enttäuscht werden.»
Wer in diesem Hype nahe der Höchstwerte eingestiegen ist, spürt jetzt die eisige Bise des Kryptowinters – im Durchschnitt haben die digitalen Assets mehr als zwei Drittel ihres Wertes eingebüsst. Besonders toxisch wirkt sich aus, wenn sich Bitcoin-Gläubige gleichzeitig als Hedge-Fund-Gurus versuchen und ohnehin schon äusserst volatile Digitalwährungen mit Krediten in luftige Höhen hebeln. So kollabierte im Juli der Krypto-Hedge-Fund Three Arrows Capital (3AC). Durch den Konkurs lösten sich USD 10 Mrd. in Luft auf. Su Zhu, Mitgründer von 3AC, war noch kurz vor dem Untergang von einem Superzyklus der Kryptowährungen überzeugt und sagte einen Bitcoin-Kurs von USD 2,5 Mio. voraus.
Der koreanische Gründer des Terra-Stablecoin, Kwon Do Hyeong, bezeichnete sich auf Twitter als «Master of Stable». Terra verfolgte das Ziel, stabil den Wert eines Dollars zu repräsentieren. Dabei wurde eine dynamische, algorithmische Absicherung gewählt. Kwon Do Hyeong schaffte es, in kurzer Zeit 40 Millionen Nutzer von seiner Kryptowährung zu überzeugen und wurde selber kometenhaft zum Milliardär. 2020 forderte er seine Follower auf: «Verbeugt Euch vor dem König.» Inzwischen ist die Bewunderung für den Krypto-Guru in Hass umgeschlagen. Die dynamische, algorithmische Absicherung erlitt Schiffbruch, und der Terra-Stablecoin ist krachend gescheitert – ebenso die mit ihm verbundene Kryptowährung Luna. Unzählige Investorinnen und Investoren haben ihr Geld verloren.
Im November ist mit FTX innerhalb eines Tages die zweitgrösste Krypto-Börse spektakulär implodiert. Dessen Gründer und Multimilliardär Sam Bankman-Fried (SBF) wurde in der August/September-Ausgabe des Magazins «Fortune» als «The next Warren Buffett» gehandelt. Er galt zwischenzeitlich mit einem Vermögen von USD 26,5 Mrd. als einer der reichsten Menschen der Welt. Möglich wurde dies, ohne ein internes und professionelles Audit sowie Controlling zu haben. Externer Bilanzprüfer war ein weitgehend unbekanntes Unternehmen, das sich damit brüstet, die erste Accounting-Firma mit Hauptsitz im Metaverse zu sein. Die Basketballlegende Shaquille O’Neill verkündete noch im Juni in einem Werbespot: «Ich bin erfreut, gemeinsam mit meinem Partner FTX dazu beizutragen, Kryptowährungen den Massen zugänglich zu machen.» Und in Anspielung auf die Poker-Ansage, das ganze Geld aufs Spiel zu setzen, fügte er hinzu: «I’m all in.» Als die Investoren Sam Bankman-Fried und seinem Unternehmen das Vertrauen entzogen, mutierte das Bankman-Märchen zum Bankrun-Albtraum: Unzählige Anlegerinnen und Anleger sind panikartig zum Ausgang gerannt. Viele von ihnen haben über Nacht einen Haufen Geld verloren, so zum Beispiel BlackRock (vielleicht wird ja der liebe Larry Fink nach diesem Rückschlag seine Meinung erneut um 180 Grad ändern …), der japanische Telekommunikations- und Medienkonzern Softbank, der Singapurer Staatsfonds Temasek, die Football- und Basketball-Legenden Tom Brady und Stephen Curry sowie der Pensionsfonds der Lehrer in der kanadischen Provinz Ontario, der im Januar letzten Jahres USD 400 Mio. in die Börse FTX gesteckt hatte. Ein herber Verlust. Vielleicht sollten die Lehrer der Provinz selbst wieder einmal die Schulbank drücken – ein Kurs über die elementaren Grundlagen der Geldanlage würde ihnen sicherlich nicht schaden. Im Gegensatz aber zu den kanadischen Lehrerinnen und Lehrern hat Sam Bankman-Fried im Grunde gar nichts verloren. Aus wenig hat er viel heisse Luft gemacht. Jetzt ist der Ballon geplatzt und die Luft ist entwichen – was soll’s? Bankman-Fried bezeichnet sich als Anhänger des «effektiven Altruismus». Damit liegt er nicht ganz falsch, denn so schnell hat wohl noch kein Multimilliardär sein ganzes Vermögen aus der Hand gegeben. Im Dezember wurde Sam Bankman-Fried auf den Bahamas festgenommen und angeklagt – es besteht der Verdacht auf Betrug. Der mit der Liquidation beauftragte John Ray, der vor 20 Jahren auch schon den monumentalen Betrugsfall Enron abgewickelt hat, sagte in einer Stellungnahme: «Noch nie in meiner Laufbahn habe ich ein derartiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein derartiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt.» Das sagt einiges über diese boomende Branche. Im Zuge des FTX-Debakels sind Investorengelder unzähliger Krypto-Funds und Krypto-Hedge-Funds in ein schwarzes Loch gefallen. The show must go on. Während der Fussballweltmeisterschaft in Katar warb der portugiesische Fussballgott Cristiano Ronaldo in den Spielpausen für die weltgrösste Kryptobörse Binance mit dem Slogan: «Join me on Binance – to the moon.»
«Der Schluss liegt nahe, dass auch kurze Hosen, lässiges T-Shirt und krause Haare eines studierten 30-jährigen Physikers schnelle Milliardengewinne nicht seriöser und risikoloser machen.»
Während es weltweit gerade einmal rund 180 «reale» Währungen gibt, existieren bereits über 20’000 Kryptowährungen – Tendenz steigend. Dabei wird teilweise auf abenteuerlichste Art und Weise «Geld» kreiert. Da gibt es zum Beispiel einen Shiba Inu Coin, der die Herzen der Spekulanten höherschlagen lässt. Der von der Hunderasse Shiba Inu inspirierte und im August vom Gründer mit dem Pseudonym Ryoshi lancierte Coin erreichte in der Spitze eine Marktkapitalisierung von über USD 35 Mrd. Inzwischen ist er um rund 80 Prozent eingedampft. Dann gibt es einen Token mit dem Namen Omicron. Dieser wurde am 8. November 2021 lanciert – ein paar Wochen, bevor der Name Omicron im Zuge der Pandemie Berühmtheit erlangte. Am 26. November 2021 verkündete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass die neue Variante des Coronavirus als besorgniserregend einzustufen ist. Und was passierte in den folgenden drei Tagen, vom 26. bis 29. November, mit dem Kurs des Omicron-Token, der rein zufällig den gleichen Namen trägt? Es ist kaum zu glauben: In einem sagenhaften Hype verzehnfachte er sich von USD 65 auf 655! Inzwischen hat nicht nur der Schrecken vor der Virusvariante abgenommen, sondern auch der Kurs des Omicron: Er war per Mitte Dezember 2022 nicht einmal mehr einen Cent wert. Dieses absurde, aber reale Beispiel illustriert die Irrationalität des Kryptomarktes.
In den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Gruppe fachkundiger und unabhängiger Informatiker, Programmierer, Ingenieure sowie Softwareentwickler zusammengetan und einen offenen Brief an den Kongress verfasst. Im Schreiben wird die Blockchain-Technologie geradezu lächerlich gemacht. Zu den Mitverfassern gehören der Harvard-Dozent Bruce Schneier, der ehemalige Microsoft-Ingenieur Miguel de Icaza und Kelsey Hightower, der leitende Ingenieur bei Google Cloud. «Krypto-Vermögenswerte sind das Vehikel für unsolide, hochvolatile und spekulative Anlagestrategien, welche aktiv bei Kleinanlegern beworben werden, die möglicherweise nicht in der Lage sind, deren Natur und Risiken zu verstehen», lassen die Autoren verlauten. Sie kommen zum Schluss, die Krypto- und Blockchain-Technologie sei nutzlos.
«Die Blockchain-Technologie ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem.»
Die amerikanische Investorenlegende Warren Buffett hält Kryptowährungen für wertlos, wie er im letzten Frühjahr an der Aktionärsversammlung in Omaha bekräftigte. Es gäbe einen Unterschied zwischen produktiven Vermögenswerten wie Aktien und Dingen, die nur davon abhängen, dass «der nächste Typ mehr bezahlt als der letzte». Im Gegensatz zu Kryptowährungen verkaufen Unternehmen Produkte und Dienstleistungen, Wohnungen werfen Miete ab und Farmen stellen Lebensmittel her. Recht hat der Altmeister.
«Auch wenn man mir alle Bitcoins der Welt für 25 Dollar anbieten würde, würde ich dankend ablehnen. Ich wüsste nicht, was ich damit tun sollte. Wer glaubt, dass die Kryptowährung eines Tages den Dollar ersetzen werde, hat den Verstand verloren.»
Der Oxford-Professor Robert McCauley weist warnend darauf hin, Bitcoin sei schlimmer als das Schneeballsystem des US-Finanzbetrügers Bernard Madoff. Während bei einem Ponzi-System nach dem Kollaps ein Teil des Geldes beschlagnahmt und den «Investoren» zurückbezahlt werden könne – McCauley beziffert diesen Anteil am Beispiel des Schneeballsystems von Madoff mit 70 Prozent der Gelder, die ursprünglich einbezahlt wurden – , sei beim Bitcoin nach einem Kollaps nichts mehr da, was den Anlegern zurückbezahlt werden könne. Dazu komme, dass bei einem Ponzi-System keine extremen ökologischen Kosten unwiederbringlich verloren seien, so wie das bei Bitcoin der Fall sei. Schliesslich würde bei einem Schneeballsystem einfach das Geld von «Anleger» A zu Betrüger B wechseln, aber es sei kumuliert betrachtet nichts unwiederbringlich verloren. Eine zugegebenermassen sehr harte Sichtweise des britischen Professors – wenn auch seine Argumente nicht leicht wegzudiskutieren sind.
Im Herbst 2021 genehmigte die Schweizerische Finanzmarktaufsicht Finma den ersten Krypto-Anlagefonds nach schweizerischem Recht. Mit dem von der Firma Crypto Finance – dessen Gründer Jan Brzezek wird von der «Finanz und Wirtschaft» als «38-Jähriger mit Haargel-gefestigter Gordon-Gekko-Frisur mit On-Turnschuhen» beschrieben – lancierten Crypto Market Index Fund können nun Frau und Herr Schweizer ihre Gelder der privaten Vorsorge (Säule 3a) in Kryptowährungen investieren. Der passive Fonds bildet die Performance der zehn grössten Kryptowährungen ab, wobei Bitcoin und Ethereum zusammen drei Viertel des Fondsgewichts ausmachen. Zocken mit unserer Altersvorsorge – eine mehr als schräge Entwicklung. Unterstützung erhalten Kryptoanlagen neuerlich auch vom Finanzmarktprofessor der Universität Zürich, Thorsten Hens. Er lässt sich in der «NZZ am Sonntag» vom 24. April 2022 zitieren, dass rund 5 Prozent eines Portfolios in digitale Vermögenswerte investiert sein sollten. Wer im Interview nach einer guten Erklärung für diese Empfehlung sucht, wird enttäuscht. Auch Thorsten Hens zählt zu den Wendehälsen. Noch am 28. September 2021 liess er sich in der «Finanz und Wirtschaft» in Analogie zu Warren Buffett zitieren, der Bitcoin entspreche nichts anderem als der berühmten Greater Fool Theory: Wer gewinnen will, suche einfach einen noch Verrückteren, der mehr für das Ding zu zahlen bereit ist.
«Bitcoin ist für mich ein völliges Mysterium. Ich würde meine Rechnungen nur damit bezahlen, wenn ich ein Drogenhändler wäre.»
Nicht nur die amerikanischen Finanzgiganten BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs und JPMorgan Chase verkaufen ihren Kunden Kryptowährungen, sondern auch Schweizer Banken. In einem Interview erzählt der CEO der Zürcher Privatbank Maerki Baumann, Stephan Zwahlen, den Lesern der «Weltwoche», wie seine Arbeitgeberin zu Bitcoin & Co. kam. Ein Journalist schrieb demzufolge ein paar Jahre zuvor, «bei Maerki Baumann können Kunden Kryptowährungen kaufen, handeln, anlegen und so weiter». Dies traf aber offenbar zu diesem Zeitpunkt gar noch nicht zu – es war eine Zeitungsente. Auch Kunden hätten diese Meldung gelesen und in der Bank die entsprechende Dienstleistung nachgefragt. Daraus schloss Zwahlen, es handle sich um eine Businessidee, die es wert sei, weiterentwickelt und umgesetzt zu werden. Zur Erinnerung: Maerki Baumann war nach der Jahrtausendwende auch die Hausbank eines gewissen Dieter Behring, der im Jahr 2018 vom Bundesgericht letztinstanzlich verurteilt wurde, weil er ein gigantisches Schneeballsystem betrieb.
«Meine Hoffnung ist, dass Bitcoin bald sozial geächtet wird und enorm an Wert verliert – und irgendwann einmal einfach stirbt.»
Gemäss einem Bericht der «NZZ» nimmt die Privatbank Vontobel für sich in Anspruch, «die Einzigen im Markt zu sein, die Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future» anbietet. Wow! Die Kombination von Bitcoin und Leverage ist der ultimative Anlage-Kick und etwa vergleichbar mit dem Risiko, das Sie auf sich nehmen, wenn Sie an einem Mittwochnachmittag in einem hochfrisierten Ferrari mit 150 Kilometern durch die Innenstadt von Zürich brettern. Das Geschäftsgebaren vieler Banken führt uns einmal mehr vor Augen: Sie haben kein Business-Modell aus innerer Überzeugung, sondern sie bieten an, was gerade gefragt oder in Mode ist.
Zu den spärlichen Kaufargumenten, die von der Bitcoin-Community vorgetragen werden, gehört dasjenige der Diversifikation respektive der tiefen Korrelation zu den traditionellen Anlagen wie Aktien oder Anleihen. Dieses Argument greift ins Leere. So hat gerade die Corona-Krise gezeigt, dass Aktienmarktrückschläge von noch heftigeren Verwerfungen der Kryptowährungen begleitet sind. Darüber hinaus ist das Argument einer tiefen Korrelation schlicht irreführend. Wer in Kuhmist investiert, hat eine Korrelation mit Aktien, die bei null liegt – es gibt schlicht keine gegenseitigen Abhängigkeiten. Trotzdem würde wohl kein vernünftiger Mensch sein Geld in Kuhmist stecken. Im Ernst: Eine tiefe Korrelation zu Anleihen oder Aktien ist natürlich nur von Nutzen, wenn die entsprechende Anlage langfristig auch Wertschöpfung generiert. Genau dies ist aber der fragliche Punkt bei Kryptowährungen.
«Bitcoin ist heute nur ein spekulatives Phänomen. Bitcoin-Enthusiasten argumentieren, der Preis müsse steigen, weil das Angebot begrenzt sei. Er soll in ihren Augen immer teurer werden, nur weil er scheinbar knapp ist, obwohl er keinen inneren Wert hat. Allein der Glaube bewegt offensichtlich die Kurse. Ich sehe keine Grundlagen, die Bitcoin einen fundamentalen Wert verleihen.»
Als Argument für langfristig steigende Kurse des Bitcoins führt der Head of Research von Bitcoin Suisse, Marcus Dapp, jenes der Knappheit an. So ist die Summe aller Bitcoins auf 21 Mio. begrenzt. Aufgrund der Limitierung und der hohen Kosten der Schürfung müsse der Kurs langfristig steigen, argumentieren die Befürworter. Eswar Prasad, Professor der Cornell University in New York, hat dazu eine klare Meinung: «Bitcoin hat keinen Wert, denn Knappheit an sich ist kein Argument», äusserte er sich in einem Interview mit der «NZZ». Es stellt sich auch die Frage: Wie kann man ernsthaft dem Argument der Knappheit folgen, wenn es weltweit schon über 20'000 Kryptowährungen gibt? Gemäss Prasad wollen libertäre Idealisten mit Bitcoin ein Zahlungsmittel schaffen, das ohne Zentralbanken und Finanzinstitute funktioniert. Das sei nicht gelungen, denn die Kursentwicklung sei sehr volatil, es seien keine grossen Transaktionsvolumina möglich, und das System sei sowohl langsam als auch teuer. Der Professor kann sich kaum vorstellen, dass all die Währungen, hinter denen niemand und nichts stehen würde, langfristig eine Zukunft haben. Kenneth Rogoff, Ökonomieprofessor der renommierten Harvard University, äussert sich in einem Beitrag der «Finanz und Wirtschaft» kompromisslos: «Angesichts von Nullzinsen kann es massive, langlebige Spekulationsblasen bei per se wertlosen Anlagewerten geben.»
Wer trotz all dieser Einwände in Kryptowährungen investieren möchte, sollte wissen, dass die Anlage oft über den Kauf börsengehandelter Kryptowährungsprodukte (sogenannte Exchange Traded Products respektive ETP) erfolgt. Dabei muss man sich bewusst sein, dass Krypto-ETPs keine ETFs (Exchange Traded Funds) sind. Während es sich bei physisch replizierten ETFs um Sondervermögen handelt, das im Konkursfall des Emittenten geschützt ist, besteht bei ETPs ein Emittentenrisiko. Geht der Emittent in Konkurs, was in der Krypto-Branche kein seltenes Phänomen ist, fällt auch das investierte Kapital in ein schwarzes Loch – der Untergang der amerikanischen Bank Lehman während der Finanzkrise lässt grüssen.
Wenn Sie sich amüsieren wollen, schauen Sie sich die Dokumentation «Die Kryptoqueen – Der grosse Onecoin-Betrug» an, die Anfang November auf «Arte» ausgestrahlt wurde. Der Film zeigt eindrücklich auf, was passieren kann, wenn «Gläubige» den Versprechungen von Kryptogurus in naiver Weise folgen. Die Deutsch-Bulgarin Ruja Ignatova hat mit einem raffinierten Schneeballsystem drei Millionen Anlegerinnen und Anleger rund um den Erdball um mindestens USD 4 Mrd. erleichtert. Die inzwischen verschollene «Kryptokönigin» verfügt über mehrere Uni-Abschlüsse, einen Doktortitel und war vor ihrer Krypto-Karriere als Associate Partner des Beratungsunternehmens McKinsey tätig. Die Kryptowelt ähnelt in ihrer Art einem Ballon. Am Anfang ist nur wenig heisse Luft drin. Dann wird der Ballon mit viel heisser Luft aufgeblasen – bis er schliesslich platzt. Deshalb gehen die Experten der EZB davon aus, dass Kryptowährungen weder als Anlageform noch als Zahlungssystem geeignet sind und früher oder später vor dem Aus stehen werden.
«Wir sollten Bitcoins verbieten. Ich bin schockiert, dass noch niemand auf diese Idee gekommen ist. Das Geschäft mit Bitcoins basiert auf Rechnern, die unfassbar viel Computerleistung benötigen und entsprechend Strom fressen. Eine einzige Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Strom wie ein Haushalt in eineinhalb Monaten. Der weltweite Bitcoin-Stromverbrauch entspricht dem doppelten Verbrauch der Schweiz.»
Auch das Thema «Nachhaltigkeit» hat in der Finanzbranche im Laufe des letzten Jahrzehnts gewaltig an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung ist grundsätzlich zu begrüssen, denn es steht ausser Zweifel, dass Handlungsbedarf besteht, insbesondere im Bereich Umwelt. Die Auswirkungen der Klimaveränderung sind eine Tatsache, die nicht in Abrede gestellt werden kann und darf. Wir sind es den nachrückenden Generationen schlicht schuldig, schonender mit den Ressourcen unseres Planeten umzugehen und erneuerbare Energien zu forcieren.
Bei aller Sympathie für Massnahmen, die unsere Umwelt verbessern, bekunden wir grosse Mühe mit dem Hype, der seit einigen Jahren die Sinne vieler Finanzdienstleister vernebelt. Quasi über Nacht und auf Knopfdruck werden Kundengelder auf Nachhaltigkeit umgestellt, und gleichzeitig wird das Märchen verkündet, die Welt sei dadurch schlagartig eine bessere geworden. Diese Entwicklung erachten wir als brandgefährlich und in höchstem Masse kontraproduktiv für die seriösen Anliegen der Nachhaltigkeit. Noch im Jahr 2011 wurden gemäss Swiss Sustainable Finance in der Schweiz gerade einmal CHF 41,2 Mrd. nachhaltig angelegt. Ende 2021 waren es bereits CHF 1'982,7 Mrd. – das entspricht etwa einer Verfünfzigfachung in einem einzigen Jahrzehnt. Laut dem Fondsanalysehaus Morningstar ist in der Europäischen Union mittlerweile mehr Geld in nachhaltigen Fonds angelegt als in herkömmlichen. Hat sich, wie man intuitiv annehmen könnte, im letzten Jahrzehnt auch das Klima explosionsartig verbessert? Leider nein, muss man desillusioniert konstatieren. Im Jahr 2021 stieg gemäss Experten der weltweite CO2-Ausstoss durch Kohle, Öl und Gas auf 36,6 Mrd. Tonnen – so hoch wie nie zuvor. Und genau das ist es, was uns ärgert: In der Finanzbranche tun wir so, als ob wir mit unserer Anlagepolitik Gutes für das Klima tun könnten. Aber genau das trifft leider in kaum wahrnehmbaren Masse zu, wie viele seriöse wissenschaftliche Studien eindrücklich beweisen. Nachhaltige Anlagen beruhigen das Gewissen, aber tragen extrem wenig zur Verbesserung der (Um-)Welt bei. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre des anliegenden Leitartikels «Nachhaltige Anlagen als Marketing-Gag», den wir in der «Finanz und Wirtschaft» vom 13. August 2022 publiziert haben. Der provokative Beitrag soll nicht etwa das Ziel einer nachhaltigeren Welt in Frage stellen. Im Gegenteil: Er soll wachrütteln und uns daran erinnern, dass eine Verbesserung der Umwelt in erster Linie von unserem Konsumverhalten, von der Politik und von innovativen Technologien getrieben sein muss. Dies sind die Treiber einer nachhaltigeren Welt – nachhaltige Anlagen sind die Folge davon.
«Nachhaltiges Anlegen durchläuft derzeit eine Phase der Konfusion – beispielsweise werden in einem Portfolio drei Titel ersetzt und der Fonds dann als grün vermarktet.»
Per Ende Juni 2022 haben gemäss dem Net-Zero Tracker von MSCI insgesamt 702 der weltweit grössten Konzerne Netto-Null-Ziele für das Jahr 2050 angekündigt – innerhalb von nur sechs Monaten ist damit der Anteil aller im Weltindex aufgeführten Unternehmen von einem Fünftel auf einen Drittel hochgeschnellt. Allerdings erfüllen gemäss Experten 65 Prozent der Unternehmen nicht einmal die Mindeststandards für die Berichterstattung über die Umsetzung der gesetzten Ziele. Es besteht deshalb der Verdacht, dass viele Unternehmen keinen glaubwürdigen Plan haben, ihre Verpflichtungen langfristig umzusetzen. Darüber hinaus stellt sich die Frage: Wie wollen wir als Anlegerinnen und Anleger eine nachhaltige Anlagepolitik glaubwürdig umsetzen, wenn schon die Ankündigungen der Unternehmen unglaubwürdig sind?
Wie widersprüchlich sich das nachhaltige Anlegen gestaltet, zeigt sich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Um die fatale Abhängigkeit vom russischen Gas und Öl zu reduzieren, gelten in der EU Erdgas und Kernkraft neuerdings als «grün». Die Reaktion der Nichtregierungsorganisation WWF folgte auf den Fuss: «Heute haben die fossilen Gas- und Atomlobbys den Jackpot geknackt, während die Menschheit den Preis dafür zahlen wird.» Gleichzeitig will die EU-Kommission mehr Geld in «grüne» Anlagen lenken. So sind Bankberater und Versicherungsvermittler im EU-Raum seit dem 2. August verpflichtet, Kundinnen und Kunden zu fragen, ob sie «grün» investieren wollen und welche Präferenzen sie diesbezüglich haben. Diese in den europäischen Finanzmarktrichtlinien festgelegten Mifid-II-Vorgaben müssen bei der Produktauswahl berücksichtigt werden. Mit der «EU-Taxonomy» soll überdies ein Klassifizierungssystem für nachhaltige Anlagen geschaffen werden. Allerdings: Wie wollen Banken und Vermögensverwalter diese Vorgaben sinnvoll umsetzen, wenn sich selbst die führenden Rating-Agenturen dieser Welt völlig uneinig sind, was überhaupt unter nachhaltigen Anlagen zu verstehen ist? Der Forscher Christian Klein, Professor für Nachhaltige Finanzwirtschaft an der Universität Kassel, stellt zurecht die Frage, wie man denn einem Kunden auf einfache Weise erklären könne, was Taxonomie und Offenlegungsverordnung (Veröffentlichung von Informationen der Finanzmarktteilnehmer zur Nachhaltigkeit ihrer Investitionsentscheidungen) bedeuten. In der Tat: Stellen Sie sich einmal vor, wir würden Sie als Kundin oder Kunde im Detail über all diese komplexen und individuell völlig unterschiedlich interpretierten Zusammenhänge informieren, damit Sie uns in der Folge Ihre persönlichen Präferenzen in Sachen Nachhaltigkeit mitteilen könnten. Ganz abgesehen von den horrenden Kosten, die mit einer solchen Umsetzung verbunden wären, würde das am Ende wohl dazu führen, dass nicht mehr wir für die Portfoliodisposition zuständig wären, sondern Sie selbst.
«Die Umsetzung der Mifid-II-Vorgaben ist für Berater ein Wahnsinn.»
Über die Gefahren des «Greenwashing» haben wir bereits in früheren Kundenbriefen und Fachartikeln berichtet. Unsere Augen ganz weit geöffnet hat uns vor einem halben Jahr ein Research-Paper der Professoren John Armour, Luca Enriques und Thom Wetzer, die an der renommierten Universität Oxford forschen. In ihrem Beitrag vom Juni 2022 zeigen sie in erschreckender Art und Weise auf, was passiert, wenn Konzerne ihre schmutzigen Geschäfte abspalten und verkaufen, um ihre Klimabilanz aufzubessern. Wenn ein Rohstoffkonzern seine Sündengeschäfte abspaltet, verbessert sich zwar schlagartig die CO2-Bilanz des Unternehmens. Wer nun aber glaubt, die Weltklimabilanz hätte sich dadurch in gleichem Masse verbessert, ist naiv. In der Regel steigt danach der Ausstoss von CO2 sogar an, weil die Käufer oft im Bereich des Private Equity zu suchen sind, die sich abgesondert vom Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit um den Klimawandel foutieren und geringere Anreize haben, die Emissionen zu reduzieren. Das Research-Paper referenziert sich auf konkrete Beispiele aus der Praxis. Thungela, ein südafrikanisches Kohleunternehmen, das von Anglo American abgespalten wurde, hat seinen Ausstoss rasch erhöht, seitdem es als eigenständiges Unternehmen tätig ist. Hilcorp, ein privates Unternehmen, das dem Private-Equity-Spezialisten Carlyle nahesteht, ist zum grössten Methanemittenten der USA geworden, nachdem es veraltete Anlagen von ConocoPhillips und BP gekauft hat. Das amerikanische Energieunternehmen Apache, das in der Förderung, der Herstellung sowie Vermarktung von Rohöl und Erdgas tätig ist, verkaufte etwa 2'100 Ölquellen im Permian Basin, das sich im Südwesten der USA befindet, an die wenig bekannte Betreibergesellschaft Slant Energy. Danach sank die Stopfrate (die Rate, mit der inaktive und undichte Bohrlöcher gestopft werden, um Methanemissionen zu verhindern) der Bohrlöcher drastisch. Unter Apache hätte es nach Angaben der Oxford-Gelehrten neun Jahre gedauert, den Rückbau der entsprechenden Bohrlöcher zu veranlassen – bei Slant Energy werden 120 Jahre veranschlagt.
Übel gestaltet sich auch, wenn schmutziges Geschäft abgespalten wird, um es danach als selbstständige Einheit auszubluten und in den Konkurs schlittern zu lassen, weil die vorhandenen Vermögenswerte zur Deckung der Umweltverbindlichkeiten nicht ausreichen. Diese Praxis sei oft bei Öl- und Gasbohrunternehmen sowie Anlagen anzutreffen, die sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern. Die Käufer hätten weder die Absicht noch die Mittel, in die Sanierung zu investieren. Diese üblen Machenschaften würden zusätzlich durch den kreativen Einsatz von Buchhaltungsmethoden gefördert, die darauf abzielen, die Sanierungsarbeiten weit in die Zukunft zu verschieben, indem behauptet wird, dass die Bohrlöcher noch jahrzehntelang produktiv seien – was sie faktisch nicht sind. Die Professoren der Universität Oxford weisen auf einen entscheidenden Fehler in den Strategien klimabewusster Investoren und Regulierungsbehörden hin. Ihr Fokus liege zu oft auf den Emissionen auf Unternehmens- oder Portfolioebene und nicht auf der Reduzierung der Emissionen an sich. Dieser Konklusion pflichten wir ohne Wenn und Aber bei. Anlegerinnen und Anleger bilden sich ein, mit «grünen» Anlagen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Gleichzeitig bleiben schmutzige Anlagen ohne das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit «dunkel», so dass die Welt bei Lichte betrachtet eine (noch) schlechtere wird.
Michelle Bachelet, chilenische Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, weist in ihrem Bericht auf «schwerwiegende Menschenrechtsverbrechen» in der chinesischen Provinz Xinjiang hin. Demzufolge wird ein grosser Teil der uigurischen Bevölkerung willkürlich verhaftet, inhaftiert, gefoltert, sexuell ausgebeutet und für Zwangsarbeit rekrutiert. Nun ist die Solarindustrie ausgerechnet auf Rohstoffe der Region Xinjiang, in der Peking Uiguren unterdrückt, angewiesen. Polysilizium ist das zentrale Material für die Herstellung von Solarzellen. Gemäss Laura Murphy, Professorin für Menschenrechte an der Universität Sheffield, stammen 45 Prozent des Polysiliziums, das weltweit für Fotovoltaikanlagen verwendet wird, aus Xinjiang – aus dem gesamten Reich der Mitte sind es sogar 80 Prozent. Es besteht kein Zweifel: Wer «grün» investieren will, setzt sich regelmässig einem Zielkonflikt aus.
«Es muss uns klar sein, dass wir mit dem Ausbau der Fotovoltaik in der jetzigen Form Unterdrückung, Zwangsarbeit und die Assimilierung der Uiguren fördern, also den chinesischen Polizeistaat.»
Wie herausfordernd sich die Umsetzung einer nachhaltigen Anlagepolitik gestaltet, musste im vergangenen Jahr auch die Genfer Privatbank Lombard Odier erfahren. Der langjährige Patron Patrick Odier und dessen Finanzinstitut verstehen sich als Aushängeschilder und führende Anbieter nachhaltiger Produkte auf dem schweizerischen Finanzplatz. Nun hat das Westschweizer Fernsehen in ihrem investigativen Film «Die Finanzindustrie wäscht grüner» die mangelnde Transparenz und fehlende Standards in der Branche schonungslos offengelegt. Der Film macht deutlich, dass Investoren mit dem Thema «Nachhaltigkeit» oft überfordert sind, was Banken geschickt zu nutzen wissen.
Recherchen des Filmteams zeigen, dass ein Fonds von Lombard Odier CHF 2 Mio. in einen Green Bond investiert hat, der vom arabischen Immobilienkonzern Majid al Futtaim herausgegeben wurde. Die Firma mit Sitz in Dubai besitzt knapp zwei Dutzend Immobilien im arabischen Raum, darunter Shoppingcenter und Vergnügungsparks. Insgesamt nahm das Unternehmen USD 1,2 Mrd. am Kapitalmarkt auf, um den CO2-Fussabdruck ihrer Gebäude zu verbessern. Die Ratingagentur Sustainalytics hat den Green Bond für gut befunden. Ein Grossteil der Gelder wurde in der Folge dazu verwendet, die Mall of Egypt in der Nähe von Kairo zu sanieren. Nun gibt es in dieser Mall of Egypt nicht nur Shops, Restaurants und Kinos – man kann auf echtem Schnee auch Ski fahren. Die Mall of Egypt beherbergt das «erste Indoor Skiresort Afrikas», wie es auf der Website heisst. Nachhaltiges Anlegen in einer Skihalle in der Wüste, wie passt denn das zusammen? Dass dort auch noch eine kleine Kolonie von Pinguinen ihre Runden dreht, war wohl die Spitze der Ironie des kritischen Films.
Wer als Finanzspezialistin oder -spezialist das Thema Nachhaltigkeit seriös angehen will, kommt nicht an den Einschätzungen weltweit führender Rating-Agenturen vorbei. Zu ihnen zählen Anbieter wie Moody’s ESG, MSCI, Refinitiv, S&P Global und Sustainalytics. Unser Haus stützt sich, neben einer eigenen Beurteilung, auf die Einschätzungen von MSCI und S&P Global ab. Wermutstropfen ist allerdings die Tatsache, dass MSCI als die «Königin unter den Nachhaltigkeitsagenturen» für das Zurverfügungstellen ihrer Daten unverschämte Honorare kassiert – die Finanzdienstleister haben rasch realisiert, dass sich mit dem Hype der Nachhaltigkeit fette Gewinne realisieren lassen. Dass dies am Ende des Tages die Kosten für die Verwaltung von Vermögen in die Höhe schraubt, steht ausser Frage. Darüber hinaus wäre es auch blauäugig zu glauben, dass diesen Research-Quellen verlässliche Schlussfolgerungen entnommen werden könnten, um nachhaltige Anlagen zu identifizieren. Eine ESG-Studie mit dem Titel «Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings», die von Florian Berg, Julian F. Kölbel und Roberto Rigobon am MIT Sloan (Cambridge, Massachusetts) verfasst wurde, untersucht die Übereinstimmung respektive Nicht-Übereinstimmung der führenden Rating-Agenturen in Bezug auf die Nachhaltigkeit von 934 ausgewählten Unternehmen. Die Ergebnisse sind erschütternd. Gemäss den Forschern gibt es so gut wie keine Übereinstimmung der Rating-Agenturen in der Beurteilung, ob ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet oder nicht.
Natürlich steht ausser Zweifel, dass jedes Rating-Unternehmen einen grossen Aufwand betreibt, um seine Schlüsse zur Nachhaltigkeit von Unternehmen zu ziehen. Aber offenbar sind die Kriterien und Prioritäten derart subjektiv, verschieden und willkürlich, dass am Ende so gut wie jedes Unternehmen als nachhaltig (oder eben auch als nicht nachhaltig) taxiert werden kann – abhängig davon, ob der Akzent mehr auf das «E» (Umwelt), das «S» (Soziales) oder das «G» (Unternehmensführung) im ESG-Universum gelegt wird. Duncan Lamont, Head of Strategic Research der britischen Bank Schroders, bringt es in der Oktoberausgabe der «Bilanz» in Bezug auf das Elektroautounternehmen Tesla wie folgt auf den Punkt: «Sie können dieses Unternehmen aus der ESG-Perspektive lieben oder es meiden wie die Pest. Das hängt davon ab, welchen Ratinganbieter Sie fragen.» Tesla galt lange als das Vorzeigeunternehmen und der Liebling aller Nachhaltigkeitsfonds. Im Mai letzten Jahres flog es aus dem ESG-Index von S&P. Unter anderem gibt es Bedenken bezüglich der Arbeitsbedingungen und Rassismusvorwürfe. Auch fehle eine kohlenstoffarme Strategie im Konzern. Zum Vergleich: Der US-Ölförderer Exxon rangiert in der ESG-Bewertung von S&P im soliden Mittelfeld. Interessant zu wissen ist überdies, dass gemäss einem Bericht der Online-Zeitung «The Market» der Risikofilter, den ESG gemäss seinem Anspruch über Finanzanlagen spannen soll, auch keinen Schutz vor dem Krieg in der Ukraine bot. So hätten Forscher der Harvard Law School dargelegt, dass die ESG-Ratings von Unternehmen mit bedeutendem Russland-Geschäft vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Schnitt sogar höher lagen als bei anderen europäischen Unternehmen – mit den entsprechenden Folgen für die Performance der Anlegerinnen und Anleger. Apropos Performance: Wenn die Festlegung, was nachhaltige und nicht nachhaltige Unternehmen sind, subjektiv und ziemlich willkürlich erfolgt, ist auch die Frage obsolet, ob nachhaltige Unternehmen besser oder schlechter performen als nicht nachhaltige. Je nach Gusto erhalten Sie das gewünschte Resultat.
«Die Industrie läuft auf Hochtouren. Manchmal hat man das Gefühl, dass sie zu rennen versucht, bevor sie gehen gelernt hat.»
Inwieweit interessiert es die Investorinnen und Investoren überhaupt, ob ihre als nachhaltig stipulierten Anlagen auch tatsächlich eine Wirkung auf die Umwelt erzielen? Julian Kölbel ist seit 2022 Assistenzprofessor für nachhaltige Finanzwirtschaft am Center for Financial Services Innovation der Universität St. Gallen. Zusammen mit seinen Forscherkollegen Florian Heeb, Falko Paetzold und Stefan Zeisberger von der Universität Zürich hat er im vergangenen September in der renommierten Fachzeitschrift «Review of Financial Studies» den Beitrag mit dem Titel «Do Investors care about Impact?» publiziert. Die Autoren gehen in ihrer Arbeit der Frage nach, ob für Anlegerinnen und Anleger die Wirkung ihrer Geldanlage überhaupt eine Rolle spielt oder nicht. Dabei fanden sie heraus, dass Investoren – unabhängig davon, ob es sich um unerfahrene oder sehr erfahrene und/oder vermögende handelt – eine substanzielle Bereitschaft haben, sich bei gleichen Produktkosten für ein nachhaltiges Anlageprodukt zu entscheiden, von dem sie annehmen, dass es eine positive Wirkung auf die (Um-)Welt erzielen würde. Allerdings scheint ihr Interesse, für die Wirkung (Impact) Geld zu bezahlen, kaum vorhanden zu sein. Im Experiment wurde ihnen die Frage gestellt, wieviel mehr sie für ein nachhaltiges Produkt zu zahlen bereit wären, wenn die Wirkung um den Faktor zehn erhöht würde – also mit einem High-Impact-Produkt der CO2-Ausstoss auf einen Zehntel reduziert werden könnte. Die Ergebnisse der Studie sind desillusionierend: Es besteht eine kaum messbare Bereitschaft nachhaltiger Investoren, einen höheren Preis für ein Produkt zu bezahlen, wenn sich die Wirkung verzehnfacht. Die Forscher kommen deshalb zum Schluss, dass zwar ein grosses Bedürfnis für nachhaltige Anlagen besteht, aber es den Investoren am Ende egal ist, ob sie mit ihren Anlagen auch tatsächlich eine Wirkung erzielen oder nicht. Es geht ihnen vielmehr um das gute Gefühl («warm glow»). Man könnte auch von «Greenwishing» (statt Greenwashing) der Anleger sprechen.
Mit guten Gründen sind wir mit unseren Kundenportfolios weiterhin in Rohstoffwerte wie BP, Shell und Rio Tinto investiert – diese Entscheidung hat sich für unsere Kundinnen und Kunden als goldrichtig erwiesen, nachdem vor zwei Jahren viele Investorinnen und Investoren diese Aktien bei teilweise negativen Ölpreisen prozyklisch und panikartig zu Schleuderpreisen verkauft haben. Bei Shell fliessen rund 20 Prozent des Investitionsbudgets in Wind- und Solaraktivitäten, die Produktion von Wasserstoff, die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid sowie naturbasierte Projekte, die Kohlendioxid vermeiden oder reduzieren. So plant der Ölkonzern den ersten Offshore-Windpark entlang der brasilianischen Küste. Klar, mit guten Gründen liesse sich ebenso argumentieren, warum aufgrund einer ESG-Perspektive nicht in Rohstoffunternehmen investiert werden sollte. Die Entscheidung, ob ein Unternehmen zu den nachhaltigen oder nicht nachhaltigen gehört, ist äusserst komplex und von einem hohen Mass subjektiver Einschätzung geprägt. Wie herausfordernd das Thema ist, sei an einem zugegebenermassen extremen Beispiel illustriert. Wenn Sie auf keinen Fall Aktien von Waffenproduzenten in Ihrem Portfolio halten wollen, würden Sie wohl kaum auf die Idee kommen, den Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont auszuschliessen. Strenggenommen wäre dies aber konsequent: Neben bekannten Marken wie Cartier und Montblanc produziert Richemont auch Gewehre für die Moorhuhnjagd der britischen Oberschicht.
«Diese Forschungsergebnisse zeigen auf, dass es für Anbieter relativ einfach ist, Greenwashing oder Impact-Washing zu betreiben in einem globalen Markt, in dem inzwischen Anlagegelder in Höhe von geschätzt rund 30 Billionen Dollar verwaltet werden.»
Es gab eine Zeit, da hatten wir Respekt für die Banker an der noblen Bahnhofstrasse in Zürich. Leider ist das lange her – sehr lange. So bezeichnet die renommierte «NZZ» die sanierungsbedürftige Credit Suisse nach ihrer gefühlt 17. Ankündigung einer Strategieänderung despektierlich als «Scherbenhaufen». Der Niedergang der Bank, die bis 1997 Schweizerische Kreditanstalt (SKA) hiess, begann im Grunde schon mit der Übernahme der amerikanischen Investmentbank First Boston im Jahr 1990 – orchestriert durch ihren damaligen Präsidenten Rainer Gut. Von der amerikanischen Kultur übernahm man damals die exorbitanten Saläre, nicht aber den für die Aktionäre entscheidenden Geschäftserfolg. Ein Skandal jagte den nächsten: Geldwäschereiverfahren mit korrupten Institutionen und Oligarchen sowie abenteuerliche Spekulationen mit undurchsichtigen Produkten, die zu Milliardenverlusten führten, stürzten die Bank in eine existenzielle Krise. Weil die Credit Suisse ihr Geldwäschereidispositiv nicht im Griff hatte, musste sie über Jahre einen externen «Aufpasser» gewärtigen, der die Fortschritte bei diesen Mängeln zu überprüfen hatte. Die Aufgabe fiel Neil Barofsky zu, Partner der amerikanischen Anwaltskanzlei Jenner & Rock. Er und sein Team sollen für diese «Aufpasserdienste» auf Kosten der Bank mehr als eine halbe Milliarde Dollar Honorar erhalten haben – auch dies ist natürlich absurd.
«Eine Bank lebt von den schlechten Geschäften, die sie unterlässt.»
Um zu überleben, sah sich die Credit Suisse jüngst gezwungen, ihr Immobilien-Tafelsilber zu verscherbeln. Nachdem sie bereits 2012 den Uetlihof an den norwegischen Staatsfonds veräussert hatte, trennte sie sich auch vom schönen Grieder-Haus, das an die Swatch Group ging, sowie vom Leuenhof, den sich die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site einverleibte. Nach der Ankündigung, das bis anhin als unverkäuflich geltende Savoy am Zürcher Paradeplatz veräussern zu wollen, verbleibt vom einst stolzen Betongold einzig noch der Hauptsitz im Besitz der Bank. In einem beschleunigten Verfahren hat die Credit Suisse auch ihren Anteil von 8,6 Prozent an der Allfunds Group bei institutionellen Investoren platziert. Ein Jahr zuvor hätte sie noch den zweieinhalbfachen Preis erhalten. Seit der Ankündigung ihrer neuen Strategie bezeichnen Spötter die Bank wieder als SKA – aufgrund ihrer in der Not an Bord geholten Grossaktionäre aus dem Nahen Osten nun aber stellvertretend für Saudische Kreditanstalt.
«Die Führung der Credit Suisse muss den Shareholder-Value-Ansatz falsch verstanden haben. Bei diesem Konzept geht es, wie der Name erahnen lässt, um den Unternehmenswert. Aber dieser soll maximiert und nicht etwa möglichst schnell vernichtet werden.»
Ist es wirklich so schwierig, eine Bank erfolgreich zu führen? Wir meinen nein. Allerdings müssen ein paar elementare Grundsätze eingehalten werden. Unseres Erachtens sind es primär drei. Erstens braucht es das Vertrauen der Kundinnen und Kunden sowie eine klare Geschäftsstrategie. Diese ist bei der Credit Suisse seit Jahren und Jahrzehnten nicht erkennbar, und das Vertrauen ist nach all den Vorkommnissen der letzten Jahre ruiniert.
«Böse Zungen stellen die Frage, ob die Credit Suisse denn bisher überhaupt eine Strategie hatte – ausser ihr Management reich und ihre Aktionäre arm zu machen.»
Zweitens braucht ein gesundes Unternehmen genügend Eigenmittel. Wenn Grossbanken gerade einmal gut 4 Prozent hartes Eigenkapital (als Mindestanforderung in der Schweiz gelten 3,5 Prozent) halten, ist das viel zu wenig. Banken verlangen von ihren Kundinnen und Kunden mindestens 20 oder 30 Prozent an Eigenmitteln, damit sie überhaupt einen Kredit erhalten. Warum geben sich Banker und Banken selbst viel laschere Standards? Der ehemalige Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, Professor Simon Johnson, der am renommierten Massachusetts Institute of Technology lehrt, fordert für systemrelevante Banken ein minimales Eigenkapital von 10 Prozent. Adnat R. Admati, Professorin für Finanzen und Wirtschaft an der Universität Stanford, und Professor Martin Hellwig, früherer Direktor am Max-Planck-Institut, fordern von den Banken sogar eine harte Eigenkapitalquote von 20 bis 30 Prozent. Das ist etwa das 5- bis 7-fache der heutigen Quoten. Bei einer Eigenkapitalquote von gut 4 Prozent, wie dies bei einer Credit Suisse der Fall ist, braucht es «nur» ein paar dümmliche Spekulationen, überflüssige Bussenzahlungen oder ein zittriges Marktumfeld, um die Bank an den Rand des Ruins zu drängen – das kann es wahrlich nicht sein. Nimmt man die guten Ratschläge der erwähnten Wissenschaftler ernst, kann man auch über eine Interviewaussage des amtierenden Präsidenten des Verwaltungsrates der Credit Suisse, Axel Lehmann, die er nach seinem Amtsantritt gemacht hat, nur den Kopf schütteln. Auf die Frage des Journalisten, wo er denn ansetzen wolle, um zum Erfolg zurückzukehren, antwortete er:
«Wir haben einen klaren Plan, den wir bekanntgegeben haben. So wollen wir bis 2024 mindestens 10 Prozent Eigenkapitalrendite haben.»
Wir rieben uns mehrfach die Augen, als wir uns die Aussage von Axel Lehmann auf der Zunge zergehen liessen. Was soll die Bekanntgabe eines Eigenkapitalrenditeziels von 10 Prozent, wenn die Bank Milliardensummen verbrennt und viel zu wenig Eigenmittel hat? Eigenkapitalrenditeziele, wie sie schon Joe Ackermann als früherer Chef der Deutschen Bank bekannt gab und damit in der Folge kläglich scheiterte, sind ein Unding. Es liegt in der Natur der einfachen Mathematik, dass Renditen umso höher ausfallen, je tiefer die Eigenmittel sind. Wenn es aber am Ende einen Anreiz für die Chefs eines Finanzinstituts (bei den Versicherungen herrscht dasselbe Übel) gibt, möglichst wenig Eigenkapital zu haben, um möglichst hohe Eigenkapitalrenditen ausweisen zu können, ist definitiv etwas faul. Stellt sich der Erfolg ein, brüstet man sich mit hohen Eigenkapitalrenditen, und die Gewinne werden sofort in Form von fetten Boni an das Kader ausbezahlt. Bleibt der Erfolg aus, übernehmen die Aktionäre den Schaden, während die Manager der Bank immer noch hohe Boni kassieren – sie würden sonst zur Konkurrenz abwandern, lautet in diesem Fall das Argument. Eigenkapitalrenditeziele sind ein Übel, denn auch eine hohe Rendite auf «viel zu wenig» ist einerseits immer noch viel zu wenig und andererseits brandgefährlich.
Drittens sollen die Banken endlich begreifen, dass sie ihren leitenden Angestellten vernünftige und leistungsgerechte Löhne ausbezahlen sollen, die unternehmerisch vertretbar sind. Alleine die Credit Suisse beschäftigt über 1'400 sogenannte «Key Risk Takers», die ein Millionensalär kassieren. 1'400! Der gebetsmühlenartig vorgetragene Hinweis, man müsse die «Talente» entsprechend bezahlen und sich am Markt orientieren, ist in jeder Hinsicht unglaubwürdig. Was sind denn das für «Talente», die systematisch den Unternehmenswert zulasten der Aktionäre plündern? Was sind das für «Talente» respektive Verlust produzierende Banker, denen CHF 300 Mio. als sogenannte «retention awards» bezahlt werden, um sie bei der Stange zu halten? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist dies: Es braucht in unserer Branche keine Halbgötter und Übermenschen, sondern solide Schaffer, die mit ihren Füssen auf dem Boden stehen. Sie sollen gut oder auch sehr gut verdienen, aber nicht das Mehrfache dessen, was vergleichbare Kader zum Beispiel in der Gesundheitsbranche oder in der Industrie erhalten.
«Würde die CS den gleichen Durchschnittslohn zahlen wie die deutlich erfolgreichere Nestlé, könnte sie gegen sechs Milliarden einsparen und wäre profitabel.»
Banker müssten eigentlich längst wissen, wie brutal die Finanzmärkte sein können. Wenn Exponenten verwundet am Boden liegen, wird erst recht auf ihnen herumgetrampelt. Das war bei Lehman Brothers und der UBS während der Finanzkrise schon so. Wenn Unternehmen taumeln, gibt es immer eine Schar von Marktakteuren, die auf ihren Konkurs spekulieren. Dies geschieht über sogenannte CDS (Credit Default Swaps). Faktisch handelt es sich dabei um ganz banale Versicherungsprämien, um eine Anleihe eines bestimmten Schuldners abzusichern. Wer Anfang 2022 eine 5-jährige Anleihe der CS gegen einen drohenden Zahlungsausfall respektive Konkurs versichern wollte, bezahlte dafür eine jährliche Prämie von 0,55 Prozent – bei einer Anlagesumme von CHF 100'000 entspricht dies einer Versicherungsprämie von CHF 550. Anfang Dezember 2022 mussten für dieselbe Versicherung bereits 4,44 Prozent beziehungsweise CHF 4’440 bezahlt werden. Die Versicherungsprämien gegen einen Zahlungsausfall der Credit Suisse haben sich somit innerhalb von weniger als einem Jahr mehr als verachtfacht. Das ist verheerend, denn damit geht eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Pleite einher. Wenn sich nun Exponenten des Finanzinstituts darüber aufregen, dass Finanzraubtiere auf fahrlässige Art und Weise auf einen Konkurs der Bank spekulieren würden, hält sich unser Mitleid in engen Grenzen. Eine Bank, die sich mit abenteuerlichen Produkten wie Archegos oder Greensill regelmässig als Zockerbude in Szene setzt – warum soll man es anderen Marktteilnehmern verübeln, wenn sie dasselbe tun und auf den Untergang des Finanzinstituts wetten? Für uns gibt es keinen Zweifel: Weiterhin machen wir einen grossen Bogen um Aktien von Grossbanken – wir setzen uns nicht an den Roulette-Tisch und wetten darauf, dass die Kugel auf «schwarz» fällt und wir unseren Einsatz verdoppeln – oder alles verlieren. Wir sind Investoren und keine Spekulanten.
«Am hohen Fieber ist wohl doch nicht der Fiebermesser schuld; Letzterer zeigt nur das Problem an. Das gilt wohl auch für die CS und deren hohe CDS-Preise.»
Was uns neben hoher Inflation, steigenden Zinsen, geopolitischer Risiken und einer schwächelnden Konjunktur am meisten sorgt, sind die weltweiten Staatsschuldentürme. In Frankreich beträgt die Verschuldung rund 110 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP), in Spanien 120, in Italien 150 und in Griechenland 200 Prozent. Die Vergemeinschaftung der Schulden klammer europäischer Staaten in der EU ist eine Fehlkonstruktion, die mit dem berühmten «Moral Hazard» verknüpft ist. Dieser besagt, dass Schuldenkönige wie Italien oder Griechenland in einer (Schicksals-)Gemeinschaft viel weniger Interesse an einem Schuldenabbau haben, als wenn sie auf sich alleine gestellt wären. Im Verbund der EU dürfen sie stets davon ausgehen, von den starken Nationen (primär Deutschland), die ein virulentes Interesse am Erhalt der Staatengemeinschaft haben, im Bedarfsfall gerettet zu werden. Echte Sparanstrengungen und ein Schuldenabbau sind deshalb bei den Krisenstaaten nicht zu erkennen. So werden Probleme nicht gelöst, sondern unter den Teppich gekehrt. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika liegt die Verschuldung bei über 130 Prozent, während sie in Japan auf alarmierende 260 Prozent geklettert ist. Ist es realistisch, dass all diese Länder ihre horrenden Schulden einst abtragen werden? Wie der Wirtschaftshistoriker der Universität Zürich, Professor Tobias Straumann, in einer Kolumne der «NZZ am Sonntag» schrieb, gibt es genau einen Präzedenzfall in der Finanzgeschichte, in der dieses Kunststück gelang: In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Gemäss dem Internationalen Währungsfonds (IMF) hatten die USA im Jahr 1945 eine Staatsverschuldung von 116 Prozent des BIP, Grossbritannien 235 und die Schweiz 79 Prozent. Drei Jahrzehnte später waren es nur noch 33, 47 respektive 42 Prozent. Wie war das möglich, und lässt sich dieses «Wunder» wiederholen?
«Die Mutter aller Schuldenkrisen könnte irgendwann in diesem oder im nächsten Jahrzehnt eintreten.»
Leider muss der Hoffnung nach einer Wiederholung des «Wunders» eine Absage erteilt werden. Der wichtigste Faktor zur Reduktion der Schuldenrelation war damals ein hohes Wirtschaftswachstum, das nach dem Krieg mit dem Wiederaufbau einsetzte. «Es gab einen enormen Nachholbedarf nach drei Jahrzehnten schwachen Wachstums, das durch die beiden Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre verursacht worden war», schreibt Tobias Straumann. Andererseits erzielten die Staaten grosse Spareffekte durch die Demobilisierung der Armee. Ein hohes Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren ist nun aber genauso unrealistisch wie eine markante Kürzung von Militär- oder anderen Staatsausgaben. Die gestiegenen und möglicherweise weiter steigenden Zinsen bilden zusätzlich eine gewaltige Belastung für die ohnehin schon hoch verschuldeten Staaten. Der giftige Cocktail hoher Verschuldung, eines erhöhten Zinsendienstes und weiterer Defizite stellt für sie eine schier unlösbare Herausforderung dar. Es drohen Staatsbankrotte und erkleckliche Steuererhöhungen. Der Urheber des «Whatever it takes», Mario Draghi, wird in Italien und in weiten Teilen Europas als Held gefeiert, weil er mit drakonischen Zinssenkungen und einer historisch beispiellosen Geldflutung Europa vor dem Kollaps bewahrte. Ist er aber bei Lichte betrachtet nicht vielmehr der Totengräber Europas, weil dadurch Reformen und Schuldensanierungen verschleppt wurden? Alarmsignale gab es bereits im vergangenen Jahr. Nach der Ankündigung der führenden Notenbanken, ihre Anleihenkäufe zu reduzieren, sind die Zinsen erheblich gestiegen und die Obligationenkurse stark unter Druck geraten. Irgendwann wird wohl die Europäische Union kaum darum herumkommen, über einen Schuldenschnitt nachzudenken – mit den entsprechenden Folgen für Banken, Versicherungen und Pensionskassen, die Anleihen hoch verschuldeter Staaten in Milliardenhöhe halten.
«Ein partieller Bankrott ist deshalb unvermeidlich. Die Frage ist nur noch, wann er vollzogen wird.»
In der Schweiz haben wir es besser. Die Staatsverschuldung liegt mit rund 27 Prozent des BIP auf einem vorbildlichen Niveau und auch die Inflation, die in Helvetien in der Spitze rund 3,5 Prozent erreichte, ist im Vergleich zu den Ländern Europas und Amerikas nicht besorgniserregend. In dieser Hinsicht ist spannend zu ergründen, warum die Schweiz bezüglich der Teuerung eine Art Insel ist. Erstens dürfte es wohl mit dem vorteilhaften Energiemix zu tun haben. Dank der Wasserkraft ist die Schweiz weniger von Gas und Erdöl abhängig und muss folglich weniger von den massiv teurer gewordenen Energieträgern importieren. Zweitens geben Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz prozentual bezogen auf ihr Budget weniger Geld für fossile Brennstoffe aus als Bürgerinnen und Bürger in Deutschland oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Gewicht von fossilen Treib- und Heizstoffen im Schweizer Landesindex der Konsumentenpreise beträgt rund 3 Prozent, während der Anteil in Deutschland über 7 und in den USA rund 5 Prozent beträgt. Das ist nicht zuletzt deshalb so, weil in der Schweiz die Löhne höher sind und damit der prozentuale Anteil für Energie tiefer liegt. Weil fossile Energien in der Schweiz überdies mit hohen Steuern belastet werden, die in der Höhe fix sind, wirken sich Ölpreisveränderungen prozentual weniger stark auf den Benzinpreis aus. Drittens dämpft der notorisch starke Franken die Inflation, weil dadurch die Importe günstiger werden. Viertens, und dies dürfte am meisten überraschen, hat die Schweiz einen hohen Anteil administrierter Preise. Ein von Eurostat erstellter Vergleich verschiedener Konsumentenpreisindizes zeigt, dass in der Schweiz 27 Prozent der Konsumentenpreise reguliert sind. In Frankreich und Schweden liegt dieser Anteil bei gut 15 Prozent, in Italien und Deutschland liegt er leicht darunter, und in Spanien sowie Österreich werden weniger als 10 Prozent der Preise staatlich administriert. Dank Regulation und der Auflage, dass die privaten Haushalte den Strom über ihren lokalen Anbieter beziehen müssen, fielen in der Schweiz die bisherigen Preiserhöhungen verhältnismässig moderat aus. In Deutschland, wo im Gegensatz zur Schweiz die Konsumenten dem freien Strommarkt ausgesetzt sind, mussten die Bürger bereits im vergangenen Jahr saftige Preiserhöhungen von über 30 Prozent verkraften.
«Wenn Sie der Bank hundert Dollar schulden, ist das Ihr Problem. Wenn Sie der Bank hundert Millionen Dollar schulden, ist dies das Problem der Bank.»
Sowohl die Verschuldungs- als auch die Teuerungsentwicklung in der Schweiz mögen besser sein als in den meisten Ländern der Welt. Begleitet ist sie allerdings von einem langfristigen «Handicap» für Schweizer Anlegerinnen und Anleger: dem hammerharten Franken! Aus unternehmerischer Sicht ist er zwar Ausdruck der wirtschaftlichen und politischen Stärke unseres Landes, doch die Kehrseite der Medaille ist die Tatsache, dass die Performance der Wertschriftenportfolios, die in Schweizer Franken rapportiert wird, im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn deutlich tiefer liegt – obwohl die Zusammensetzung der Portfolios identisch ist. Portfolios, die wir zum Beispiel für deutsche Kundinnen und Kunden in der Referenzwährung Euro führen, weisen per Ende November 2022 im Vergleich zu unserer Schweizer Klientel eine deutlich höhere Rendite aus. Das liegt natürlich alleine an der Schwäche des Euros, der in den ersten 11 Monaten des vergangenen Jahres rund 5 Prozent gegenüber dem Schweizer Franken verlor. Wichtig ist deshalb dies: Ob Ihre Rendite 5 Prozent höher (in EUR) oder tiefer (in CHF) liegt, spielt höchstens psychologisch eine Rolle – währungsbereinigt ist es dasselbe.
Mit der Erhöhung der Leitzinsen durch das Fed, die EZB und die SNB ergibt sich für Anlegerinnen und Anleger eine längst erhoffte Entspannung: Die Zeit der Negativzinsen gehört endlich der Vergangenheit an. Geld hat wieder einen Wert. Wer es jemandem leiht, erhält einen Zins. Das ist gut so. Ist dadurch die Situation für Investorinnen und Investoren aber auch eine bessere geworden? Nicht wirklich. Vergleichen wir die heutige Situation mit dem Jahr 2020. Damals hatten wir in der Schweiz eine negative Teuerung (Deflation) von –0,7 Prozent. Wer seiner Bank (im Falle hoher Kontobestände) 0,75 Prozent Negativzins bezahlen musste, verzeichnete unter dem Strich auf realer Basis ziemlich genau ein Nullergebnis. Heute verrechnen die Banken auf Spargeldern zwar keinen Negativzins mehr, aber sie bezahlen weiterhin kaum Zinsen. Bei einer Inflation von 3,0 Prozent entsteht sodann ein realer Kaufkraftverlust in gleicher Höhe – die Situation hat sich für Anlegerinnen und Anleger auf realer Basis deutlich verschlechtert. In Deutschland und Amerika ist die Situation bei Inflationsraten von 10 oder knapp 8 Prozent noch dramatischer – wer sein Geld auf dem Konto parkt, verliert rasch an Kaufkraft. Dies nennt man finanzielle Repression. Weil die Staatenwelt hoffnungslos überschuldet ist, werden die Zinssätze weit unter der Teuerung gehalten, damit sie sich auf realer Basis auf Kosten der Sparer entschulden kann. Das heisst nichts anderes als dies: Investorinnen und Investoren sind geradezu gezwungen, Risiken einzugehen, um ihr Kapital real erhalten oder vermehren zu können. Die hohe Inflation zwingt uns förmlich dazu, in Realwerte wie Aktien zu investieren. Eine Studie von Guido Baltussen, Finanzprofessor an der Erasmus Universität in Rotterdam, hat in diesem Zusammenhang analysiert, wie sich Aktien, Anleihen und Cash in Phasen hoher Inflation seit 1875 entwickelt haben. Wenig erstaunlich ist dabei die Tatsache, dass real alle Anlagen an Wert verloren haben. Interessant ist aber zu wissen, dass Aktien in Zeiten von starken Teuerungsschüben mit einer jährlichen Negativrealrendite von 1,7 Prozent noch am vorteilhaftesten abgeschnitten haben. Im Vergleich dazu haben Anleihen und Cash teuerungsbereinigt jährlich über 4 Prozent an Wert eingebüsst. Es bringt also nichts, aus Angst vor hoher Inflation das Geld unter die Matratze zu legen. Schliesslich gibt es keinen Zweifel daran, dass Aktien den besten Inflationsschutz bieten und langfristig die höchsten Renditen erzielen, auch wenn sie kurzfristig heftig schwanken können.
«Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand dafür interessiert.»
Wie geht es an den Kapitalmärkten weiter? Sie wissen es: Nicht nur wir wissen es nicht, niemand weiss es. Was wir aber wissen, ist die Tatsache, dass Verwerfungen an den Börsen immer begleitet sind von grosser Unsicherheit, die gleichzeitig Chancen für antizyklische Anlegerinnen und Anleger bietet. Zwar gibt es unzählige Argumente, mit Käufen zuzuwarten, wenn das Börsenwetter von Regen, Donner und Hagel begleitet ist: Der Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, trübe Konjunkturaussichten oder potenziell tiefere Unternehmensgewinne sprechen für eine defensive Haltung. Doch sei an dieser Stelle wieder einmal mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass – im Unterschied zu unserem «normalen» Leben – die Psyche und unser Bauchgefühl die grössten Feinde unseres Anlageerfolgs sind. Die meisten Investorinnen und Investoren kaufen nämlich dann Aktien, wenn die Sonne scheint, die Unternehmensgewinne sprudeln, Frieden herrscht und die Konjunktur brummt. Psychologisch mag dies nachvollziehbar sein, aber am Ende nicht erfolgsdienlich. Besser beraten sind Anlegerinnen und Anleger, die den Mut aufbringen, ihr Geld antizyklisch zu investieren, wenn es draussen blitzt und stürmt. Zwar wissen wir nie, wann der Tiefpunkt erreicht ist, aber genau die Weltuntergangsstimmungen an den Börsen sind es, die antizyklischen Investorinnen und Investoren grosse Chancen bieten. Und vergessen Sie nicht: Die Märkte drehen nicht, wenn die Sonne wieder scheint, sondern sie drehen, wenn das Licht am Ende des Tunnels etwas weniger trüb erscheint als einen Tag zuvor. Wenn der Wind nicht mehr mit 140, sondern nur noch mit 135 Kilometern die Stunde durch die Gassen bläst. Dazu kommt, dass nach Erreichen des Tiefpunktes die positiven Gegenbewegungen jeweils heftig ausfallen können. Das war am Ende der New Economy-9/11-Krise zur Jahrtausendwende, der Finanzkrise von 2007 bis 2009 und auch der kurzen, aber heftigen Corona-Baisse im Jahr 2020 nicht anders. Aus langfristiger Perspektive ist es deshalb besser, zu früh einzusteigen respektive nachzukaufen, als gar nicht investiert zu sein. Natürlich braucht es dazu Mut, und den absoluten Tiefpunkt erwischt man sowieso nicht – oder höchstens zufällig. Aber das spielt langfristig auch keine Rolle. Hauptsache ist, dass man die Nerven nicht verliert und im Falle vorhandener Liquidität die Chancen günstiger Einstiegskurse nutzt, um zu investieren.
«Ich würde jedem langfristigen Investor einen Blick in die Geschichte empfehlen. Wer in Krisen wie 1987, 1991, 1998, 2001 oder 2008 und 2009 dem Markt den Rücken gekehrt hat, der hat riesige Chancen verpasst.»
Der Oktoberausgabe der «Bilanz» entnahmen wir ein Interview mit dem Chefvolkswirt der Bantleon Bank, Daniel Hartmann. Auf die Frage, wie er die weitere Entwicklung der Aktienmärkte beurteilen würde, antwortete er: «Der Zeitpunkt für den Einstieg kommt mit dem konjunkturellen Tiefpunkt, und der wird frühestens Mitte 2023, vielleicht erst Ende 2023, erreicht sein. Bis dahin sehe ich eine weitere Korrektur von mindestens 20 Prozent.» Wer weiss, vielleicht wird ja die Prognose des Bankers tatsächlich noch eintreffen – zumindest bis Mitte Dezember lag er aber komplett falsch. So oder anders unterliegt er einem doppelten Irrtum. Erstens erreichen die Aktienmärkte in der Regel ihren Tiefpunkt, längst bevor die Konjunktur ihren Tiefpunkt erreicht. Börsen eilen der realen Entwicklung oft um ein halbes bis ganzes Jahr voraus. Zweitens sind Prognosen darüber, wo die Märkte in sechs oder zwölf Monaten stehen werden, reine Kaffeesatzleserei. Es ist erstaunlich, mit welcher Persistenz gewisse Banker ihre jährlichen Prognosen verkünden, obwohl sie mit ihnen regelmässig scheitern.
«Praktisch jeder Privatanleger ist ein langfristiger Investor, aber nur, bis die Märkte abstürzen.»
Erfreulich ist die Tatsache, dass sich als Folge der negativen Marktentwicklung im vergangenen Jahr die zukünftigen Renditeperspektiven deutlich aufgehellt haben. Wer Teile seines Vermögens in Anleihen investiert, erhält wieder einen positiven Zins. Erleichtert sind wir im Weiteren darüber, dass höhere Risiken im Geschäft mit Anleihen wieder mit höheren Zinsen einhergehen. Selbstverständlich werden wir weiterhin unsere Finger von Junk Bonds, deren Inhaber sich in der Vergangenheit fast blind auf die Unterstützung der Notenbanken verlassen konnten, lassen. Konservatives und qualitätsorientiertes Investieren wird wieder belohnt.
«Wenn man billig einkauft, muss man Geduld mitbringen und abwarten, bis der Markt einem zustimmt.»
Sind durch den Zinsanstieg Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver geworden? Nein, nicht wirklich. Denn die aktuelle Börsenbaisse und höhere Zinsen verbessern nicht nur die zukünftige Renditeerwartung der Anleihen, sondern auch der Aktien. So ist deren Bewertungsniveau zwischenzeitlich markant gesunken. Auch wenn weitere Korrekturen nie ausgeschlossen werden können, sind Dividendenpapiere nun definitiv nicht mehr überteuert. Es gibt zunehmend attraktive Aktien, die gleichzeitig als eigentliche Renditeperlen ins Auge stechen. Sie sind im Zuge der Börsenkorrektur attraktiver geworden und die Dividendenrenditen haben sich entsprechend erhöht. Wenn Banker ihren Kundinnen und Kunden nach dem markanten Zinsanstieg empfehlen, vermehrt in Anleihen umzuschichten, ist das eine Mär. Unter Einbezug von Inflationsüberlegungen gilt das Gesagte erst recht. Anleihen sind aber weiterhin geeignet, um als sichere Anlage die kurz- und mittelfristigen Lebensbedürfnisse abzudecken, oder als Substitut für die Liquiditätshaltung auf einem Konto – insbesondere dann, wenn das Gegenparteirisiko der Bank virulent ist.
Vergessen Sie nicht, liebe Kundinnen und Kunden: Das Durchstehen von Börsenbaissen ist zwar immer wieder von bitteren Momenten begleitet, aber immer in diesen Phasen wird die Basis für die nächste Hausse gelegt. Jede Hausse beginnt in der Finsternis und auf dem Tiefpunkt einer Börsenbaisse – wenn es draussen blitzt, stürmt und hagelt. Darüber hinaus gilt als gesichert, dass Aktien langfristig die mit Abstand attraktivste Anlageklasse sind und auch bleiben werden. Der Preis für die langfristig überragende Rendite von Aktien ist aber, dass wir zwischenzeitlich leiden müssen. Was schliessen wir daraus? Wenn Sie überschüssige Liquidität besitzen, die Sie langfristig investieren können und wollen, gibt es nun interessante Perspektiven. Dabei empfehlen wir stets ein gestaffeltes Anlegen, da niemand den perfekten Einstiegszeitpunkt kennt. Und für alle Gelder, die bei uns heute schon investiert sind, gilt eine eiserne Regel: Halten Sie auch in unsicheren Zeiten an Ihrer langfristigen Strategie fest.
«Bärenmärkte machen Anleger reich. Nur wissen sie es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.»
Für unsere Schweizer Kundinnen und Kunden noch dies: Die Optimierung unserer finanziellen Eigenvorsorge wird immer wichtiger. Nebst der privaten Vorsorge gilt das insbesondere im Kontext einer Frühpensionierung, eines Stellenwechsels, einer Scheidung oder einem Eintritt in die Selbstständigkeit, was in allen Fällen zu hohen Freizügigkeitsgeldern führen kann, die oft suboptimal in teure Produkte angelegt oder praktisch zinslos geparkt werden. Die Zusammenarbeit mit professionellen Vorsorgestiftungen ermöglicht es uns seit dem vergangenen Jahr, ab einem Betrag von rund CHF 800'000 die Freizügigkeitsgelder unserer Schweizer Klientel zu verwalten. Die Umsetzung erfolgt gebührenschonend mit unserer seit Jahrzehnten bewährten Anlagepolitik respektive mit Direktanlagen hoher Qualität. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, uns bei Interesse zu kontaktieren.
Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Denkanstösse für Verbesserungen unserer Dienstleistung haben sollten, lassen Sie uns dies bitte jederzeit wissen. Unser Anspruch ist es, nicht nur in der Champions League der (unabhängigen) Vermögensverwalter zu spielen, sondern uns weiter zu verbessern. Als sehr geschätzte Kundinnen und Kunden sind Sie unser wertvollstes Kapital, und wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Für das neue Jahr 2023 wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben das Beste, vor allen Dingen Gesundheit. Für das grosse Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, bedanken wir uns ganz herzlich und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Mit herzlichen Grüssen, im Namen des ganzen «Hotz-Teams», Ihr
Dr. Pirmin Hotz