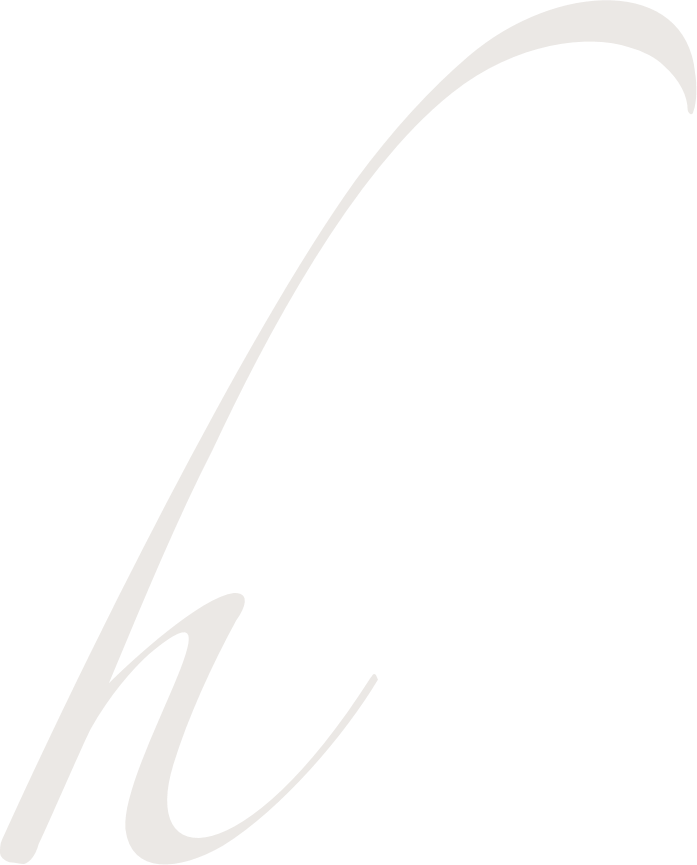Halbjahresbericht 2023
Was lange als undenkbar galt, ist Realität geworden. Die im Jahr 1856 vom mächtigen Zürcher «Eisenbahn-König» Alfred Escher gegründete Schweizerische Kreditanstalt (SKA) ist sang- und klanglos untergegangen. Mehrere Managergenerationen haben die heutige Credit Suisse durch ihre Unfähigkeit geplündert und ruiniert.
Im Juli 1856 offerierte die neu gegründete SKA der Öffentlichkeit 9'000 Aktien zum Kauf. Das Interesse war enorm, so dass das Angebot fünfzigfach überzeichnet wurde. Es herrschte Aufbruchstimmung im 1848 gegründeten schweizerischen Bundesstaat. Der private Eisenbahnbau war zentral für die Entwicklung einer modernen, international verflochtenen Industrie. Von Anfang an erlebte die Bank eine bewegte Geschichte mit existenzbedrohenden Verlusten und zahlreichen Reorganisationen. In den 1970er-Jahren wurde die Latte mit ambitionierten Zielen höher gelegt. Gemäss dem Wirtschaftshistoriker Dr. Luca Froelicher, der in der «NZZ» vom 28. März 2023 einen Beitrag zur Chronik der Bank publizierte, sagte im Jahr 1972 der damalige Präsident der Generaldirektion, Eberhard Reinhardt, zu einem neuen Mitarbeiter: «Setzen Sie die SKA auf die Landkarte des internationalen Geschäfts.» Dieser neue Mitarbeiter, auf dem damals so grosse Hoffnungen ruhten, war der gebürtige Baarer Rainer E. Gut. Der Chiasso-Skandal, der die Bank im Jahr 1977 erschütterte und ihr einen existenzbedrohenden Verlust in Milliardenhöhe eintrug, spülte Gut an die Spitze der Bank. Der weltmännisch wirkende und in der Weltfinanzmetropole New York ausgebildete Gut ging 1978 eine Zusammenarbeit mit der amerikanischen Investmentbank First Boston ein. Eine fatale Entscheidung, wie wir nicht erst heute wissen. Der Traum der Banker an der Zürcher Bahnhofstrasse, im Konzert der übermächtigen und erfolgreichen amerikanischen Investmenthäuser eine relevante Rolle zu spielen, wird zum Albtraum.
«How did you go bankrupt?», Bill asked. «Two ways», Mike said. «Gradually and then suddenly.»
Was viele nicht wissen: Der Abstieg der Schweizerischen Kreditanstalt, die seit den 1990er-Jahren unter dem Namen Credit Suisse firmiert, begann bereits in jener Zeit. 1988 übernahm die Bank im Rahmen einer Rettungsaktion eine 45-prozentige Beteiligung an der amerikanischen Investmentbank First Boston, bevor sie diese im Jahr 1990 vollständig einverleibte – respektive einverleiben musste, weil sich First Boston mit Junk Bonds gewaltig verspekuliert hatte. Seit dieser Zeit war das Problem der Credit Suisse, aber auch ihrer Konkurrentin UBS, die im Jahr 2008 vom Staat vor dem Konkurs gerettet werden musste, im Grunde immer dasselbe. Man orientierte sich an den Traumsalären der Champions an der Wall Street, spielte aber mit «Kickern» aus der zweiten und dritten Liga. Gegen die schnellen Colts der Cowboys in Manhattan hatten die behäbigen «Bänkler» am Paradeplatz schlicht keine Chance. Es reihten sich Flops an Flops und Skandale an Skandale. Dazu gesellten sich abenteuerliche Spekulationen wie beispielsweise mit Lex Greensill und Archegos, dreckige Geschäfte mit Oligarchen, korrupten Diktatoren und Beamten sowie üble Geldwäschereifälle, die Bussen in Milliardenhöhe nach sich zogen. Die Geschichte der letzten Jahrzehnte beschreibt ein systemisches Versagen unzähliger Verwaltungsräte und Konzernchefs an der Zürcher Bahnhofstrasse.
«In schlechten Zeiten kann man sie nicht brauchen, und in guten Zeiten braucht es sie nicht.»
Nicht nur das Gebaren und die notorische Unfähigkeit des Managements werfen Fragen auf, sondern auch die Rolle der Regulierungsbehörde FINMA. So verkündete ihre Präsidentin Marlene Amstad in der Ausgabe der «NZZ am Sonntag» vom 26. März 2023, notabene eine Woche nach dem Untergang der Credit Suisse: «Letztlich war es ein Bank-Run, der Bank ging die Liquidität aus.» Daran ist sicherlich nichts falsch, doch noch wenige Tage zuvor verkündete die Aufseherin, die Bank sei stark kapitalisiert und auch die Liquiditätssituation sei sehr solide. Das passt irgendwie nicht zusammen. Weiter verlautete die FINMA-Präsidentin, die «Bank habe mangelhaft kooperiert und sich geweigert, die nötigen Konsequenzen zu ziehen». Die Misswirtschaft bei der Credit Suisse halte bereits seit Jahren an. So habe die FINMA im Falle des Skandals mit Lex Greensill zwar kritische Fragen gestellt. Diese seien aber nicht etwa von der Bank selbst, sondern von Leuten von Greensill beantwortet worden.
«Es ist, als hätte man einfach den Sturzbetrunkenen selbst gefragt, ob er denn noch nach Hause fahren könne.»
Was in aller Welt nützt denn eine Finanzmarktaufsicht, wenn sie über Jahre das Fehlverhalten einer systemrelevanten Bank zwar moniert, faktisch aber keine Wirkung bei den Bankverantwortlichen erzielt? Jedes nicht systemrelevante Finanzinstitut wäre wohl nach all den Verfehlungen und Flops, die sich die Credit Suisse über Jahre geleistet hat, längst abgewickelt worden. Vorübergehend stand der Schweizer Steuerzahler mit einem Maximalbetrag von CHF 259'000'000’000 – über CHF 30'000 pro Einwohnerin und Einwohner – im Risiko. Nach dem Untergang der Swissair im Jahr 2001 und dem Kollaps der UBS während der Finanzkrise im Jahr 2008 ist das eine weitere Schmach und Schande für die Schweiz auf dem internationalen Finanz- und Wirtschaftsparkett.
«Als Erstes im Bankgeschäft lernt man Respekt vor Nullen.»
Besonders störend an der neuerlichen Rettungsaktion des Bundes ist die unsägliche und spätestens seit der Zeit des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi zur Mode gewordenen «Whatever-it-takes»-Politik. Wenn Staaten und Banken zu gross sind, um sie in den Konkurs schicken zu können («too big to fail»), werden sie von den Steuerzahlern faktisch um jeden Preis gerettet. Das führt zwangsläufig zu «Moral Hazard» – Staaten und Manager systemrelevanter Banken können unverantwortlich und nach Belieben das Geld anderer ausgeben und abenteuerliche Spekulationen, Geldwäscherei sowie Abzockerei betreiben. Ohne Folgen, weil man diese Institute niemals fallenlassen kann. Und jede Bankergeneration, die gerade am Ruder ist, weist alle Schuld von sich – sie müsse sich leider mit einem Haufen von Altlasten herumschlagen, lautet die immer wieder artikulierte Ausrede. Diese mantraartig verbreitete Selbstreinwaschung der verantwortlichen Manager der Credit Suisse nahm im Jahr 1977 ihren Anfang, als ihr der berühmte Chiasso-Skandal einen Milliardenverlust eintrug. Gegen 50 Jahre Pleiten, Pech und Pannen – nun ist die Geschichte der 167-jährigen Traditionsbank und ihrer Nieten in Nadelstreifen zu Ende erzählt. Ihr letzter Präsident, Axel Lehmann, ist als Retter angetreten. Nun wurde er zum Totengräber. Selbstkritik? Fehlanzeige. Auch das hat Tradition. Ein SKAndal.
«Die Schweiz sieht ihren Finanzplatz eigentlich immer von aussen bedroht. Namentlich von neidischen Konkurrenten in London und New York. Doch die grössten Risiken sind jeweils ganz nah, in den Teppichetagen der Banken in Zürich. Sie heissen Arroganz und Dummheit.»
Nun hat die einstige Komapatientin UBS die CS übernommen und ist erst recht «too big to fail». Alarmierend ist, dass ihr neuer und alter Kapitän Sergio Ermotti schon in seiner ersten Amtszeit den Leitsatz «lieber too big to fail als too small to survive» geprägt hat. Bei allem Respekt für das gesunde Selbstbewusstsein des erfahrenen Managers darf nicht vergessen werden, dass auch «seine» UBS im Jahresbericht der Finanzmarktaufsicht FINMA vom 28. März dieses Jahres in unmissverständlicher Deutlichkeit für deren «grosse Schwächen im Bereich Risikomanagement und Risikokontrolle» im Zusammenhang mit der Pleite des amerikanischen Hedge Funds Archegos gerügt wurde. «Die UBS ging bewusst eine Geschäftsbeziehung mit einem intransparenten Kunden mit zweifelhaftem Ruf und potenziell erhöhter Risikobereitschaft ein», heisst es im Bericht. Darüber hinaus habe sich die Bank «erhebliche Mängel bei Risikomodellen und -methoden» geleistet. Klar, der Verlust der UBS betrug «nur» USD 861 Millionen, während sich derjenige seiner ehemaligen Konkurrentin auf USD 5 Milliarden belief – vergleichbar ist das aber etwa mit einem Cup-Fussballspiel, in dem ein Drittligist einen Fünftligisten ausschaltet. Man darf gespannt sein, wie lange es dauert, bis der Grössenwahn der Bonus-getriebenen Banker im nächsten Desaster endet. Wer weiss, vielleicht schnürt die Schweiz dann erstmals ein Hilfspaket in Billionenhöhe (1 Billion = 1'000 Milliarden).
«Die Zeit der Feuerwehreinsätze ist vorbei.»
Mit dem Untergang der Credit Suisse sind auch Pflichtwandelanleihen der Bank, sogenannte AT1-Anleihen respektive CoCos (Contingent-Convertible Bonds), im Wert von USD 17 Milliarden wertlos geworden. Solche hochverzinslichen Ramsch-Anleihen, die im Krisenfall zur Sanierung herangezogen werden können, lagen auch in den Büchern institutioneller Anleger. So soll Pimco, die Fondstochter des deutschen Versicherungskonzerns Allianz, über USD 800 Millionen mit CS-CoCos verloren haben. Auch die Pensionskasse des Detailhandelsriesen Migros hat es erwischt. Gemäss deren Geschäftsführer Christoph Ryter erlitt die Vorsorgekasse mit CoCo-Bonds aufgrund des CS-Debakels einen dreistelligen Millionenverlust. Dazu gesellen sich gewaltige Verluste auf Aktien der Bank, die praktisch wertlos geworden sind. Wir können es nicht genug betonen, was wir schon seit Jahren und Jahrzehnten propagieren: Hände weg von Hochrisikoanleihen respektive Junk Bonds.
Bei der Qualität und den Risiken von Anleihen bleiben wir eisern. So haben wir in unserer 37-jährigen Firmengeschichte noch keinen einzigen Schuldnerausfall hinnehmen müssen. Wir waren weder beim Konkurs der Swissair an Bord, noch beim Debakel rund um Gazprom oder Russian Railways, deren Inhaber hochverzinslicher Anleihen faktisch einen Totalverlust hinnehmen mussten. Keine Frage, dass wir auch bei den CoCos der Credit Suisse mit keinem einzigen Franken investiert waren. Was bei uns nicht einmal für risikowillige und risikofähige Kunden infrage kommt, beurteilt der Fondsmanager der Zürcher Kantonalbank, Thomas Kirchmair, anders. In der «Finanz und Wirtschaft» vom 10. Mai dieses Jahres ist zu lesen, dass Kirchmair den konservativen (!) Kunden der Staatsbank hochverzinsliche und äusserst spekulative CoCos der Genfer Kantonalbank und der UBS empfiehlt. Dass die Zürcher Kantonalbank ihren konservativen Kunden CoCos empfiehlt, die jüngst im Kontext des CS-Untergangs für unrühmliche Schlagzeilen sorgten, ist schwer verdaulich. Darüber hinaus empfiehlt Kirchmair Anleihen der Helvetia-Versicherung mit ewiger Laufzeit (Perpetuals). Das ist sehr mutig, vielleicht aber auch übermütig, denn die risikoaversen Kunden der Bank gehen mit ewigen Anleihen sehr hohe Zinsrisiken ein, ohne ihr Kapital zu einem fixen Zeitpunkt zurückzuerhalten.
«Wenn Sie einen Schweizer Bankier aus dem Fenster springen sehen, springen Sie hinterher. Es gibt bestimmt etwas zu verdienen.»
Lassen Sie uns über Erfreuliches berichten. Die meisten Prognostiker und Analysten gingen Anfang 2023 davon aus, dass die Aktienmärkte insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres weiter schwächeln würden. Gründe dafür gab es genug. Eine weltweit stark steigende Inflation, in die Höhe schiessende Zinsen, Rezessionsängste, sinkende Unternehmensgewinne, der Krieg in der Ukraine und Drohgebärden Chinas gegenüber Taiwan gehörten zu den prominentesten Argumenten für eine pessimistische Grundhaltung. Wie so oft kam es anders, und es zeigte sich einmal mehr, was von kurz- bis mittelfristigen Prognosen zu halten ist: nichts! Bei Redaktionsschluss dieser Zeilen per Mitte Juni standen die weltweiten Aktienmärkte deutlich höher als zu Jahresbeginn. Besonders erfreulich ist dabei die Tatsache, dass die Performance-Ergebnisse unserer Kundinnen und Kunden signifikant besser ausfallen als diejenigen der relevanten Indizes und unserer bedeutenden Wettbewerber. Dies, nachdem wir bereits das Jahr 2022 im relativen Quervergleich rekordverdächtig stark abgeschlossen haben. Erstaunlich ist diese erfreuliche Tatsache vor dem Hintergrund, dass im bisherigen Jahresverlauf – ganz im Kontrast zum Vorjahr – Wachstumswerte (Growth-Titel) die von uns bevorzugten Substanzaktien (Value-Titel) meilenweit hinter sich liessen. Obwohl wir defensiv aufgestellt sind, haben wir somit nicht nur in der Baisse bewiesen, dass unsere Strategie Resistenz zeigt, sondern auch in der eingesetzten Erholungsphase erfolgreich ist. Das freut uns gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden sehr. Wie kam diese erfreuliche Entwicklung in diesem Jahr zustande? Die Gründe hängen primär damit zusammen, dass wir mit unserer antizyklisch gesteuerten Branchen- und Titelselektion hervorragend positioniert sind und seit vielen Jahren auf das Halten von Bankaktien verzichten.
«Experten prognostizieren nicht, weil sie es wissen, sondern weil sie gefragt werden.»
Viele private sowie institutionelle Investorinnen und Investoren legen ihr Geld passiv in Indexprodukte an. Das ist zweifellos eine gut vertretbare und oft erfolgversprechende Strategie, denn mit Indexanlagen respektive sogenannten Exchange Traded Funds (ETF) lässt sich der schweizerische oder deutsche Aktienmarkt genauso replizieren wie der Weltaktienmarkt oder spezifische Anleihenmärkte. Darüber hinaus sind ETF gebührenschonend. Durch den Einsatz von Indexprodukten ergibt sich eine breite Diversifikation, und Anlegerinnen und Anleger brauchen sich um die Auswahl der einzelnen Titel nicht zu kümmern. Trotzdem sind wir entschieden der Meinung, dass das passive Investieren in ETF nicht nur aus Rendite-, sondern insbesondere auch aus Risikoüberlegungen nicht die optimale Anlagestrategie ist. Virulent wurden die Defizite von Indexprodukten im schwierigen Finanzjahr 2022, wie unser am 19. April in der «Finanz und Wirtschaft» erschienene Leitartikel, der diesem Schreiben anliegt, schonungslos offenlegt. Wer zu Beginn des letzten Jahres in ETF investiert war, besass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch russische Anleihen oder Aktien. Institutionelle Anleger wie Banken, Pensionskassen und Versicherer, aber auch Privatinvestoren wurden mit solchen Wert(los)papieren, darunter die in Schweizer Franken emittierten Anleihen von Gazprom, Russian Railways und VTB Bank, auf dem falschen Fuss erwischt. Daraus entstand weitgehend ein Totalverlust. Zudem wurden viele Osteuropa- und Russland-Fonds geschlossen oder sogar liquidiert. Compenswiss, der Ausgleichsfonds der AHV, der IV und der EO, hat mit russischen Anlagen über CHF 200 Millionen verloren – als ob unser Altersvorsorgewerk nicht schon genügend offene Baustellen hätte, um seine Zukunft zu sichern.
Zwar besitzt das passive respektive indexierte Investieren Eigenschaften, die auch wir sehr zu schätzen wissen. Dazu gehört das langfristige und kostenbewusste Denken. Aktien von Unternehmen mit hervorragender Qualität kaufen und halten wir am liebsten für die Ewigkeit. Allerdings ist das passive Investieren mit inhärenten Klumpenrisiken verbunden und äusserst prozyklisch. Von diesen Risiken wurden indexorientierte Anleger im Jahr 2022 kalt erwischt. So hielten sie einen hohen Anteil überbewerteter Technologieaktien, während sie bei günstig bewerteten Rohstoff- und Energieaktien untervertreten waren. Mit festverzinslichen Anleihen haben passiv-indexierte Anleger geradezu rekordverdächtige Verluste eingefahren, weil in der Tiefzinsphase die Laufzeiten in prozyklischer Weise markant ausgeweitet und vermehrt qualitativ fragwürdige Schuldner in die Indizes aufgenommen wurden. Dies hat zu historischen Verwerfungen geführt. Als krasses Beispiel sei die 100-jährige Österreich-Anleihe erwähnt, die im Jahr 2020 emittiert wurde und zu 0,85 Prozent verzinst wird – was im damaligen Negativzinsumfeld überragend war. Der Kurs erreichte gegen Ende 2021 einen Spitzenwert von über 137 Prozent. Im Zuge der Zinswende ist er um über 70 (!) Prozent auf einen Wert von 40 Prozent eingebrochen.
«Indexfonds kaufen systematisch zu hoch und verkaufen zu niedrig.»
Die Genfer Privatbank Pictet gibt mit der Veröffentlichung der Pictet-Indexrenditen einen repräsentativen Überblick über die Ergebnisse von passiv verwalteten Vermögen. Demgemäss haben Vermögen mit einem Aktienanteil von 25 Prozent im Jahr 2022 eine Durchschnittsrendite von rund –14 Prozent erzielt. Während die Durchschnittsrendite bei einem Aktienanteil von 40 Prozent bei rund –15 Prozent liegt, beträgt diese bei einem Aktienanteil von 60 Prozent rund –16 Prozent. Es spielte also im vergangenen Jahr kaum eine Rolle, wie hoch der Aktienanteil der Pensionskassen war – konservative wie risikobereite Anleger wurden mit zweistelligen Verlusten von –14 bis –16 Prozent hart getroffen. Unsere Erfahrung und unsere Ergebnisse für unsere Kundinnen und Kunden zeigen, dass mit einer aktiven, antizyklischen und Klumpenrisiken vermeidenden Anlagepolitik ein Grossteil dieser Verluste zu verhindern war.
«Anleger sind prozyklisch. Sie machen das, was in der Vergangenheit gut gewesen wäre. Genau das Gegenteil müssten sie tun, sie sollten kontrazyklisch investieren.»
Die grösste schweizerische Pensionskasse ist die Publica, die Pensionskasse der Bundesangestellten. Betreut werden darin über 100'000 Aktivversicherte und Rentner. Das Anlageportfolio umfasst über CHF 45 Milliarden. Die Rendite der Publica betrug im Jahr 2022 –9,7 Prozent. Die Publica wird von führenden Pensionskassen-Consultants beraten. Es sind dies die niederländische ORTEC Finance sowie die schweizerischen c-alm und PPCmetrics. Wirft man einen Blick auf die Anlagestruktur der Publica, kommt Irritation auf. Wie kann erklärt werden, dass nur gerade 3 Prozent der Gelder in solide Schweizer Aktien investiert werden, während der Anteil hochriskanter Schwellenmarktaktien zwischen 7 und 8 Prozent beträgt? Dazu kommen weitere 7 bis 8 Prozent, die in nicht weniger riskante Anleihen der Schwellenmärkte angelegt sind. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die hohen Risiken dieser Märkte nicht adäquat in Form von Renditen entschädigt werden. Erstaunlich ist auch, dass der jeweilige Anteil an Private Equity, illiquiden Infrastrukturanlagen und wenig renditeträchtigen Edelmetallen ähnlich hoch ist wie derjenige in Schweizer Aktien. Fragwürdig ist überdies, warum insgesamt nur rund 25 Prozent des Gesamtvermögens in Aktien, der renditemässig klar attraktivsten Anlageklasse, alloziert sind. Verbunden mit der Hoffnung und Überzeugung, dass es die Schweiz und deren Staatspersonal auch in 100 Jahren noch geben wird, stellt sich die Frage: Macht das für eine Pensionskasse, die einen fast unendlich langen Anlagehorizont hat, auch wirklich Sinn? Wir kommen zu einem kritischen Schluss: Es wäre wohl eher ein Aktienanteil von 40 oder 50 Prozent angezeigt. Im Wissen, dass Renditen und Risiken zu über 90 Prozent von der Anlagestruktur dominiert werden, gibt es bei der Publica Optimierungspotenzial.
Der norwegische Staatsfonds, der ähnlich aufgestellt ist wie eine Pensionskasse und mit Anlagen von über CHF 1'200 Milliarden der weltweit gewichtigste Aktienbesitzer ist, zeigt, wie man es besser macht. Er hält sich an den wissenschaftlich erhärteten Grundsatz, dass Aktien als produktives Realkapital langfristig die mit Abstand attraktivste Anlageklasse repräsentieren. So investieren die Norweger zu rund 70 Prozent in Aktien, zu 25 Prozent in Anleihen und zu 5 Prozent in Immobilien. Der Staatsfonds ist seit Jahrzehnten äusserst erfolgreich und hat bezüglich langfristiger Rendite geradezu Vorzeigecharakter. Nach dem Vorbild des norwegischen Staatsfonds liesse sich nach unserer Überzeugung das Risiko/Rendite-Verhältnis bei vielen schweizerischen Pensionskassen und Versicherungen deutlich steigern. Stattdessen stellt ein Heer von Beratern, Risiko- und Compliance-Managern zwar in nahezu perfekter Weise sicher, dass alles Mögliche und Unmögliche gemessen und kontrolliert wird, aber der Blick auf das Wesentliche droht dabei verloren zu gehen. Spitze Zungen behaupten, Consultants hätten ein Interesse an Komplexität, um ihre Honorare zu steigern. So wird unter dem Deckmantel der Diversifikation in alle möglichen und unmöglichen Anlagekategorien investiert, die Anlegerinnen und Anleger im Grunde gar nicht brauchen. Um die «spezialisierten» Hedge-Fund-, Private-Equity- oder Emerging-Market-Manager zu evaluieren, bieten die Consultants schliesslich aufwendige und teure «Searches» an – was am Ende zulasten der Performance der Investorinnen und Investoren geht. Unser Ziel ist das Gegenteil: Die Komplexität für unsere geschätzten Kundinnen und Kunden soweit wie möglich zu reduzieren. Unser Ziel ist es, die Netto-Performance zu optimieren. Eine «Wünsch-Dir-was-Politik», wie sie in der Finanzwelt üblich ist, lehnen wir ab. Wir vertreten eine klare Meinung zum Wohle unserer Mandantinnen und Mandanten – auch wenn sie von einigen Bankern und Consultants nicht immer gerne gehört wird.
Die Schwellenmärkte, die ihrerseits prominent in passiv verwalteten Indexmandaten vertreten sind, sind ein gutes Beispiel, um unsere These zu untermauern. Wie Sie wissen, verzichten wir seit langer Zeit auf Anlagen in den sogenannt aufstrebenden Ländern respektive Emerging Markets. Über die multinationalen Unternehmen, die wir in unseren Portfolios führen, decken wir die Schwellenländer bereits optimal ab, denn Konzerne wie Nestlé, Holcim oder Siemens erzielen einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze in diesen Märkten. In früheren Kundenbriefen haben wir die politischen und wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten in Ländern wie China oder Russland ausführlich thematisiert – die Korruption und die Risiken einer Enteignung in totalitären Ländern sind enorm. Nun ist auch Indien in den Fokus kritischer Finanzanalysten geraten, nachdem im ersten Quartal dieses Jahres das amerikanische Finanzhaus Hindenburg Research einen Bericht veröffentlicht hat, der der indischen Adani-Gruppe vorwirft, den «grössten Betrug der Wirtschaftsgeschichte» begangen zu haben. Gautam Adani gilt als Industrie-Mogul und Aushängeschild der indischen Wirtschaft, der über ein breit verzweigtes Rohstoff- und Industriekonglomerat herrscht. Er ist der grösste Flughafenbetreiber des Landes, besitzt das grösste Hafen- und Logistikunternehmen sowie den grössten Energiekonzern. Adani soll über Jahrzehnte Aktien manipuliert, Schulden vertuscht sowie Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung im grossen Stil begangen haben. Nach Veröffentlichung des Berichts von Hindenburg Research – die Firma ist benannt nach dem deutschen Luftschiff, das 1937 über New Jersey in Flammen aufging und 36 Passagieren das Leben kostete – sind die Aktien der Adani-Gruppe an der Börse regelrecht kollabiert. Auch wenn sich der Kurs zwischenzeitlich wieder erholt hat: Für uns ist diese Geschichte eine weitere Bestärkung darin, auf riskante Anlagen – sei es in Form von Direktanlagen oder margenträchtigen Fonds – in Emerging Markets zu verzichten.
Wer viel Geld hat, kann spekulieren; wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren; wer kein Geld hat, muss spekulieren.»
Selbstverständlich bleiben wir von den Auswirkungen gewisser Risiken auf unsere westlich geprägten Unternehmen, die einen signifikanten Umsatzanteil in den Emerging Markets erzielen, nicht verschont. Ausgeprägt zeigt sich dies am deutschen Chemieunternehmen BASF, das unter den westlichen Sanktionen gegen Russland besonders zu leiden hat. Deren Tochtergesellschaft Wintershall Dea, an der BASF 70 Prozent hält, besitzt Beteiligungen an Gasfeldern in Westsibirien. Darüber hinaus besteht über die beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2, die russisches Erdgas durch die Ostsee geführt haben respektive führen sollten, eine Verflechtung mit Gazprom. Während die Lieferungen über Nord Stream 1 im September 2022 eingestellt wurden, konnte Nord Stream 2 schon gar nicht in Betrieb genommen werden. Für BASF entstand daraus ein Abschreiber von EUR 7,3 Milliarden, der naturgemäss den Aktienkurs stark belastete. Im Unterschied zu russischen Direktanlagen wie beispielsweise Gazprom hat sich der Aktienkurs von BASF jedoch von seinem per Ende September 2022 erreichten Tiefstand wieder kräftig erholt. BASF gehört in ihrer Branche zu den weltweiten Marktführern und ist breit abgestützt.
Viele Experten kaufen Aktien respektive Fonds von Schwellenländern, weil deren Bewertung viel günstiger ist als diejenige der etablierten Märkte. Tatsächlich liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis vieler Emerging Markets weit unter 10, während es in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Deutschland oder der Schweiz zwischen 15 und über 20 liegt. So war am 22. Mai in der Online-Zeitung «The Market», deren Lektüre wir sehr zu schätzen wissen, zu lesen, dass Schwellenmärkte aufgrund ihrer günstigen Bewertung für die nächsten 10 Jahre besonders hohe jährliche Realrenditen erwarten lassen würden («The Market» beruft sich auf eine Studie von Research Affiliates). Wer beispielsweise in brasilianische Aktien investiert, könne eine jährliche Rendite von 19,3 Prozent (!) erwarten. Während Schwellenmärkte insgesamt eine jährliche Rendite von 8,2 Prozent abwerfen würden, seien für die Industrieländer gerade einmal 3,3 Prozent zu erwarten. Die Prognoserechnungen sind natürlich Nonsens. Die scheinbare Attraktivität der «billigen» Schwellenmärkte ist bei Lichte betrachtet eine Fata Morgana, denn die notorisch tiefe Bewertung ist eine logische Folge der viel höheren Inflation und damit des viel höheren Zinsniveaus in diesen Ländern. Als Konsequenz daraus werten sich langfristig Währungen wie der brasilianische Real, der philippinische Peso, die türkische Lira oder der russische Rubel massiv ab, so dass währungsbereinigt unter dem Strich nur ein Bruchteil dessen übrig bleibt, was die scheinbar tiefe Bewertung erwarten liesse. Mit anderen Worten: Schwellenmärkte müssen systematisch günstiger bewertet sein als die etablierten Märkte, um die langfristige Abwertung der Währung zu antizipieren. Und oft reicht selbst dies nicht aus: Russische Aktien wurden vor dem Krieg gegen die Ukraine mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 4 bewertet und waren so gesehen spottbillig. Das schützte sie nicht vor einem Totalabsturz.
Mit multinationalen Unternehmen, die in den aufstrebenden Märkten stark präsent sind, aber ihren Sitz in einem demokratisch geprägten Land haben, fühlen wir uns wesentlich wohler als mit Direktanlagen oder Fonds in den Schwellenmärkten. Unsere Haltung bestätigt sich nicht nur unter Risiko-, sondern auch unter Performance-Gesichtspunkten. Während die Performance der Schwellenmärkte (MSCI Emerging Markets) von 2010 bis 2022 in der Referenzwährung Schweizer Franken bei jährlich 1,3 Prozent liegt, beträgt sie für die entwickelten Länder (MSCI Developed Markets) 7,5 Prozent. Der Unterschied ist monumental. Untersuchungen der britischen Wissenschaftler Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton, die die Periode von 1900 bis in die Gegenwart analysiert haben, zeigen überdies, dass auch die sehr langfristige Performance von Schwellenmarktaktien klar hinter derjenigen der entwickelten Länder liegt. Nichtsdestotrotz predigen viele Consultants ihren Kunden, mit margenträchtigen Anlagen in Schwellenmärkten könne man überproportional von deren hohen Wachstumsraten profitieren – bei Lichte betrachtet ein Märchen.
«Es gibt unendlich viele Wege, auf denen Menschen zum Erfolg kommen können, aber das Scheitern folgt häufig ähnlichen Mustern. Deshalb können wir mehr aus den Geschichten jener lernen, die gescheitert sind, als von den Erfolgreichen.»
Ab und zu werden wir gefragt, wofür «Hotz» denn eigentlich steht: Sind wir ein aktiver oder ein passiver Vermögensverwalter? Tatsächlich ist es unter Banken, Vermögensverwaltern und Consultants üblich, die Anlagewelt ziemlich sakrosankt in «aktiv» und «passiv» zu unterteilen. Entweder wird zum Beispiel mittels Hedge Funds wie wild nach Überrendite gejagt, oder man investiert in langweilige Indexprodukte. Mit dieser sturen Unterteilung können wir nichts anfangen, denn es ist uns wichtig zu betonen, wie zentral es für uns ist, die Vorzüge der aktiven und der passiven Anlagewelt in der «Hotz-Philosophie» zu vereinen. Somit sind wir weder entschieden gegen passives Anlegen, noch sind wir dafür. Und genauso sind wir weder entschieden gegen aktives Anlegen, noch sind wir dafür. Unser Ziel ist es, aktiv zu entscheiden, was wir langfristig (also ziemlich passiv) halten wollen. Wir sind konsequent aktiv, wenn es darum geht, sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien Qualität von Ramsch zu trennen – und notabene all dieser Ramsch befindet sich auch in den passiven Indizes. Ebenso wollen wir Klumpenrisiken aus Risikoüberlegungen aktiv vermeiden – diese geht ein, wer in Indizes investiert. So repräsentieren alleine die drei Titel Nestlé, Novartis und Roche über 50 Prozent des schweizerischen Aktienmarktes SMI. Wir halten alle drei dieser qualitativ erstklassigen Titel – aber niemals mit diesem Gewicht. Aktiv handeln wir auch im Umgang mit den Laufzeiten unserer festverzinslichen Anleihen. So haben wir, entgegen den passiven Indizes, unsere Risiken in Form der Duration in Zeiten von Negativzinsen antizyklisch sehr kurz gehalten. Das hat uns nach erfolgter Zinswende vor grossen Kursverlusten mit Anleihen bewahrt – ganz im Gegensatz zu passiven Anlegern, die gewaltige Verluste erlitten. Aktiv sind und handeln wir auch, wenn es bei Marktrückschlägen und Verwerfungen antizyklische Chancen zu packen gilt, um uns gegen potenzielle Übertreibungen und Exzesse an den Märkten zu stemmen. Allerdings sind wir niemals, beispielsweise getrieben von äusserst unsicheren Prognosen, aktivistisch. Wir bezeichnen unsere Anlagephilosophie deshalb gerne als semiaktiv. Weil wir kein Interesse an unnötigen Umschichtungen haben, gilt bei uns der Grundsatz: So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und vor allem wollen wir aktiv entscheiden, was wir wollen und nicht wollen.
«Fragen Sie nie einen Frisör, ob Sie einen Haarschnitt brauchen.»
Hie und da werden wir auch gefragt, was wir vom legendären Warren Buffett halten würden, und ob er denn unser Vorbild in seiner Anlagepolitik sei. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir haben grössten Respekt vor der unternehmerischen Leistung von Warren Buffett und seinem bald 100-jährigen Partner Charlie Munger, aber sie sind nicht unsere anlagepolitischen Vorbilder. Was uns sicherlich verbindet, ist die hohe Affinität für erstklassige Aktien von Unternehmen mit einem überzeugenden und langfristig erfolgreichen Geschäftsmodell. Wie Buffett sind auch wir wertorientiert und grundsätzlich konservativ. Auch teilen wir mit dem Altmeister eine tiefe Skepsis für alle Arten von Alternativen Anlagen wie Hedge Funds, Private Equity, Strukturierte Produkte und Kryptowährungen. Allerdings unterscheiden wir uns geradezu fundamental in der Frage, wie ein Aktienportfolio zusammengesetzt sein soll. Während uns eine breite, international ausgewogene Diversifikation mit, je nach Depotgrösse, 30 bis 70 Aktien von grösster Wichtigkeit ist, geht Warren Buffett enorme Wetten ein. Das zeigt ein Blick auf seine aktuelle Portfoliostruktur. So bestehen rund 40 Prozent seines gesamten Berkshire-Hathaway-Portfolios aus einer einzigen Aktie, derjenigen von Apple. Bei aller Sympathie für dieses tolle Unternehmen, das auch wir in unserem Titeluniversum führen: Ein solch gewaltiges Klumpenrisiko würden wir niemals eingehen. Eine breite Diversifikation und Risikostreuung der Anlagen ist uns heilig, denn auch die besten Unternehmen der Welt sind nicht gefeit vor nicht voraussehbaren Risiken und Rückschlägen. Neben Apple machen bei Warren Buffett alleine die sechs Titel Bank of America (11,2 Prozent), Chevron (9,8 Prozent), Coca-Cola (8,5 Prozent), American Express (7,5 Prozent), Kraft Heinz (4,4 Prozent) und Occidental Petroleum (4,1 Prozent) den überwiegenden Teil des «Restportfolios» aus. Zudem investiert Buffett fast ausschliesslich in amerikanische Unternehmen. Auch wenn es sich bei seinen Anlagen um multinationale Konzerne handelt, distanzieren wir uns vor dieser Einseitigkeit. Zudem nehmen wir im Kontrast zur Politik von Warren Buffett auch keine Kredite auf, um mittels Leverage die verwalteten Vermögen unserer Kundinnen und Kunden zu hebeln.
«Ich halte es für unsinnig, dass heutzutage an den Universitäten gelehrt wird, dass eine breite Diversifikation bei Aktienanlagen absolut obligatorisch ist. Das ist verrückt.»
Die Vergangenheit lehrt uns, wie eine Konzentration von Titelrisiken in Kombination mit Leverage im Extremfall enden kann. Martin Ebner, der Schweizer Starbanker der 1990er-Jahre, musste zur Jahrtausendwende leidvoll erfahren, was es heisst, mangelhaft diversifiziert zu sein und zu hohe Kredite zu haben. Nach seinem finanziellen Absturz im Zuge des Platzens der Dotcom-Blase und der 9/11-Krise musste er von Weggefährten (gemäss informierter Quellen soll es sich dabei insbesondere um den Unternehmer und Alt-Bundesrat Christoph Blocher gehandelt haben) gestützt werden, um wieder auf die Beine zu kommen. Nein, geschätzte Kundinnen und Kunden, wir lieben zwar die witzigen Sprüche des legendären Warren Buffett und seines Compagnons Charlie Munger. Aber anlagetechnische Vorbilder sind sie für uns nicht. Wir leben mit grosser Überzeugung die Philosophie «Hotz», die im Bereich der Aktien auf eine breite Diversifikation von weltweit führenden Unternehmen und eine tendenzielle Gleichgewichtung der Titel setzt. Eine ausgewogene Risikostreuung ist uns von fundamentaler Bedeutung.
Ashish Lodh, Ana Harris und Foties Kassianidis vom führenden Indexanbieter MSCI haben die Aktien des MSCI Europe nach Performancetreibern aufgesplittet und dabei eine wichtige Erkenntnis gewonnen: «In den letzten 20 Jahren erklärten Länder durchschnittlich 15% der Performance, die Sektoren jedoch 51%». Wie Sie wissen, steuern wir unsere Aktienallokation primär nach Sektoren respektive Branchen und erst sekundär nach Ländern. Dies auch deshalb, weil eine Einteilung multinationaler Unternehmen nach Ländern immer schwieriger wird. Einige haben ihren Sitz im Land A, machen aber am meisten Umsatz in Land B, während ihre Aktien in Land C kotiert sind – sollen diese Unternehmen im Wertschriftenverzeichnis unter Land A, B oder C aufgeführt werden? Die Entscheidung fällt in einigen Fällen sehr schwer. Unsere seit vielen Jahren gelebte Praxis der Aktiensteuerung nach Branchen wird durch die Studie von MSCI untermauert. Wissenschaftlich bestätigt wird auch unsere gelebte Praxis, Aktien nicht nach Marktkapitalisierung, sondern tendenziell gleich zu gewichten. Alexander Swade, Sandra Nolte, Mark Shackleton und Harald Lohre von der Lancaster University haben im November 2022 einen interessanten Beitrag im renommierten «Journal of Portfolio Management» veröffentlicht. Für den amerikanischen Aktienmarkt und die Zeitperiode von Juli 1963 bis Dezember 2021 fanden die Forscher heraus, dass Aktienportfolios, die gleichgewichtet werden, um jährlich 2,2 bis 3,5 Prozent (die Spanne ist abhängig vom gewählten Aktienuniversum respektive Index) höher rentierten als kapitalisierungsgewichtete Portfolios. Als ein wesentlicher Grund wird das Vermeiden von prozyklischen Klumpenrisiken genannt.
«Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft Du auch verstehst.»
Wie im Buch des Schreibenden «Über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger» erläutert, legen wir grossen Wert darauf, die richtigen Akzente in unserer Anlagepolitik zu setzen. Wir sind Anhänger von Realwerten, insbesondere von qualitativ erstklassigen Aktien. Bestätigt wird diese Überzeugung durch das Buch «Aktien für die Ewigkeit» von Professor Jeremy J. Siegel, der an der Wharton School der University of Pennsylvania lehrt. Im Oktober letzten Jahres ist dessen 6. Auflage erschienen, die wir als Lektüre wärmstens empfehlen. Siegel errechnet die Renditen der wichtigsten Anlageklassen für eine Zeitperiode, die über 200 Jahre umfasst. So haben US-Aktien trotz vieler Kriege und Verwerfungen, die in dieser langen Frist stattgefunden haben, seit 1802 im Durchschnitt eine teuerungsbereinigte Realrendite von jährlich rund 7 Prozent abgeworfen – weit mehr als jede andere Anlageklasse. Bei Anleihen beträgt die Realrendite jährlich 3,6 Prozent und bei Gold bescheidene 0,6 Prozent. Neben Aktien befürworten wir einen signifikanten Anteil an Immobilienanlagen, wobei Privatinvestoren in der Schweiz und Deutschland nicht selten «überimmobilisiert» sind und Wohnungen, Häuser oder eine Ferienwohnung besitzen, so dass sich im Wertschriftenportfolio kein zusätzliches «Betongold» aufdrängt. Cash und erstklassige Anleihen, die für die nächsten Jahre als Lebensgrundlage zu dienen haben, runden die Portfolios unserer Kundinnen und Kunden ab.
«Wenn Sie zehn Jahre Zeit haben, investieren Sie zu 100% in Aktien, und fertig.»
Mit unserer gebührenschonenden und transparenten Politik stemmen wir uns mit Überzeugung gegen den Trend der Branche, zunehmend in alle möglichen und unmöglichen Anlagealternativen zu investieren: in intransparente, illiquide, hochmargige und mit viel Fremdkapital gehebelte Hedge Funds und Private Equity, in hochriskante Schwellenmarktanlagen und Junk Bonds, in oft undurchsichtige Infrastrukturprojekte und in Kryptowährungen. Das Hauptargument der Protagonisten dieser Anlageklassen ist im Grunde immer dasselbe: Man zielt auf eine breite Diversifikation der Anlagen. Wie Sie wissen, sind wir grosse Anhänger einer breiten und ausgewogenen Diversifikation, weil es die sichere Prognose nicht gibt. Eine breite Streuung der Aktien und Anleihen ist deshalb aus Risikoüberlegungen absolute Pflicht. In alle möglichen und unmöglichen Anlagekategorien zu diversifizieren, für deren Produkte die Anbieter jährliche Gebühren von 1, 2, 3 oder gar über 6 Prozent abzwacken, liegt aber definitiv nicht in unserem Interesse, und schon gar nicht im Interesse unserer geschätzten Kundinnen und Kunden. Bei einem Grossteil der mit Hochdruck vermarkteten Alternativen Anlagen werden nämlich nur die Anbieter reich, während die Anleger abgezockt werden. Exemplarisch zeigt sich dies an einem aktuellen Beispiel, das in der Finanzindustrie für Schlagzeilen sorgte. Der 87-jährige US-Amerikaner Carl Icahn hat als Aktionärsaktivist und Hedge-Fund-Manager im Laufe der vergangenen Jahrzehnte Weltruf erlangt und ein Milliardenvermögen aufgebaut. Seit fast 10 Jahren spekuliert er nun aber auf sinkende Aktienmärkte und hat seit 2014 für seine Investoren und für sich selbst ein Vermögen von USD 9 Milliarden in den Sand gesetzt. Er hätte schlicht vergessen, sich an seine eigenen Prinzipien zu halten, lautete seine lapidare Erklärung für seinen Niedergang. Tja, wir bleiben bei unseren Prinzipien. Spekulieren ist nicht unser Ding, wir sehen uns als Investoren.
«Im Bereich Private Equity wird es vermutlich noch mehr Verluste geben, die wie aus dem Nichts auftauchen.»
Als Anhänger von Aktien haben wir im Grunde ein grosses Herz für Private Equity. Es handelt sich hierbei um produktives Realkapital, das im Sinne des Unternehmertums langfristig überragende Renditen verspricht. Viele Anbieter dieser Branche prahlen denn auch mit jährlichen Renditen von 10 bis 30 Prozent, was zunehmend institutionelle, aber auch private Anleger in diese Anlageklasse lockt. In jüngster Zeit hat nun aber von wissenschaftlicher Seite die Kritik an diesen Traumrenditeversprechen massiv zugenommen. Ludovic Phalippou ist Professor of Financial Economics an der renommierten University of Oxford und forscht seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Private-Equity-Renditen. In einem zynischen LinkedIn-Kommentar vom 28. Februar 2023 äusserte er sich zur Branche und ihrem amerikanischen Private-Equity-Marktführer KKR: «Gratulation an KKR, die in ihrem gestrigen Bericht eine IRR-Bruttorendite (Internal Rate of Return) von jährlich 25,6 Prozent für alle ihre Private-Equity- und Immobilien-Funds seit ihrem Auflagedatum rapportierten. Das ist dieselbe Rendite, wie sie KKR bereits letztes Jahr, vorletztes Jahr und so weiter verkündete. Auch die Renditen für diejenigen Fonds, die vor 1996 aufgelegt wurden, werden mit 26,1 Prozent ausgewiesen. Somit sind es jetzt mindestens 20 Jahre, für die KKR jährliche Renditen von rund 26 Prozent rapportiert. Die anderen Private-Equity-Firmen machen dasselbe.»
Der Wissenschaftler mokiert sich darüber, dass KKR über zwei Jahrzehnte lang für jedes einzelne Jahr praktisch dieselbe Rendite rapportiert – was angesichts von diversen Krisen, die diese Zeit überschatteten, völlig unrealistisch und unmöglich erscheint. In einem Tweet vom 21. März 2023 legt Phalippou nach. So schreibt er, dass Beratungsunternehmen wie McKinsey die IRR-Renditen als wahre Renditen betrachten würden, obwohl jedermann wisse, dass sie Bullshit seien. So würde niemand in der Branche die immer wieder kolportierten 25 oder 30 Prozent Rendite erzielen. «Das Gehen über Wasser ist realistischer», schreibt der Forscher. «Aber Consultants nehmen diese Zahlen, lieben sie und sagen: Lieber Kunde, investiere nicht in Private Equity, indem Du ganz auf Dich alleine gestellt bist. Schau Dir die Unterschiede der Renditen an, die die Branche erzielt, denn die Selektion der Manager ist wichtig. Du brauchst jemanden mit Erfahrung wie mich und frage nicht, wieviel ich Dir belaste, denn es ist irrelevant. Ich denke, schau mal: 30 Prozent!» Ludovic Phalippou ist knüppelhart in seinem Urteil über Private Equity und sagt offen, dass die von der Branche kolportierten Renditen nichts anderes als Bullshit seien – das deckt sich mit unseren Erfahrungen.
«Im Geschäft mit Private Equity mangelt es nicht an Betrug. So sind die Renditeberechnungen absolut unehrlich.»
Warren Buffett teilt die Ansicht von Professor Phalippou und wies an einer Investorenkonferenz im Januar 2023 darauf hin, dass es absurd sei, wie Private-Equity-Firmen Renditen berechnen würden. Während bei der Berechnung ihrer Fees auch die Kundengelder eingerechnet würden, die gar noch nicht abgerufen wurden, würden exakt diese Gelder bei der Renditeberechnung rausgerechnet, um die Performance zu frisieren. In der Tat: Private-Equity-Firmen jonglieren wie wild mit Zahlen und beschönigen ihre Performanceergebnisse. Wer wissen möchte, wie Private Equity über einen langen Zeitraum tatsächlich rentiert hat, wirft am besten einen Blick auf kotierte Private-Equity-Gesellschaften, deren Performance über die Börse transparent nachvollziehbar ist. Für einen Private-Equity-Basket, der unter anderem die börsennotierten Princess Private Equity (Partners Group), Private Equity Holding (Alpha Associates) und Castle Private Equity (Fürstenbank LGT) enthält, haben wir die Performance für die Periode vom 1.1.2000 bis 30.4.2023 errechnet. Die Ergebnisse sind ernüchternd, beträgt doch die jährliche Rendite der Private-Equity-Gefässe miserable –0,7 Prozent (minus!). Das ist weit schlechter als die Rendite von kotierten Schweizer Aktien, die in derselben Periode jährlich 4,8 Prozent Rendite abgeworfen haben.
«Private Equity ist nicht so gut, wie es ausschaut. Wenn ich ein Pensionskassenverwalter wäre, wäre ich sehr vorsichtig gegenüber dem, was mir offeriert wird.»
Wer den Zinseszinseffekt kapiert hat, weiss, was dieser Unterschied bedeutet. Aus CHF 1'000, die Anfang 2000 in einen Basket von Private-Equity-Beteiligungsgesellschaften investiert wurden, resultierte bis Ende April 2023 ein Betrag von CHF 849 – mit kotierten Schweizer Aktien erreichte das Investment einen Endbetrag von CHF 2'986. Was für ein Unterschied! Die transparent nachvollziehbaren Resultate von Private Equity liegen Galaxien von den Renditen entfernt, die die Branche in ihren genialen Marketingbroschüren und Slideshows anpreist. Interessant ist auch, dass beispielsweise im schwierigen Jahr 2022 der von Princess Private Equity ermittelte Nettoinventarwert lediglich um 1,6 Prozent an Wert verlor, während ihre an der Börse kotierte Aktie um satte 42 Prozent absackte. Diese eklatante Diskrepanz zwischen der vom Anbieter völlig legal kolportierten, buchhalterisch berechneten Rendite und der effektiven Marktrendite ist kein Einzelfall – auch bei anderen Branchenvertretern wie der Private Equity Holding lässt sich dasselbe «Phänomen» nachweisen. Der Markt gibt damit ein klares Zeichen, was er von internen Renditeberechnungen (IRR) der Private-Equity-Häuser hält: nichts. Trotzdem investiert zum Beispiel die Pensionskasse der Stadt Zürich leidenschaftlich in Private Equity und andere intransparente Anlagen wie Hedge Funds.
«Der Markt ist der einzige demokratische Richter, den es überhaupt in der modernen Welt gibt.»
Mikkel Svenstrup, Chief Investment Officer der grössten dänisch-staatlichen Pensionskasse ATP, verglich im Herbst letzten Jahres an der IPEM Private Equity Conference in Cannes das Anlagesegment Private Equity gar mit einem Schneeballsystem. Damit steht er nicht alleine da. Auch Vincent Mortier, Chief Investment Officer des grössten europäischen Vermögensverwalters Amundi Asset Management, erkennt Eigenschaften eines Schneeballsystems («Amundi warns that part of private equity markets resemble Ponzi schemes», «Financial Times» vom 1. Juni 2022). So verweisen beide Kritiker darauf, dass Buyout-Firmen sich ihre Beteiligungen zunehmend gegenseitig verkaufen würden, um ihr Business aufzupolieren. In seinen eigenen Private-Equity-Funds stellte Svenstrup nämlich fest, dass im Jahr 2021 mehr als 80 Prozent der Portfolioverkäufe entweder an eine andere Buyout-Firma gingen oder es sich um sogenannte «continuation fund deals» handelte. Bei diesen veräussert eine Private-Equity-Firma eine Unternehmensbeteiligung von einem Fonds an einen zweiten, wobei die entsprechende Private-Equity-Firma beide Fonds beherrscht. Mikkel Svenstrup weiss, wovon er spricht, denn er hat mit ATP und ihren rund 150 Buyout Funds einen umfassenden Überblick über das Business. Gemäss Svenstrup sei es auch üblich, dass die IRR-Renditen im Geschäft mit Private Equity massiv manipuliert würden. Untermauert wird dieser Vorwurf durch einen Bericht der «Financial Times». Aus ihm geht hervor, dass durch gezielte Transaktionen die Performance Fees nach oben getrieben würden. Das sind harte Vorwürfe, die ins Mark der Branche zielen.
Dass es im Segment von Private Equity, wie von Warren Buffett festgestellt, nicht an Betrug mangelt, zeigt das Beispiel Theranos. Die Amerikanerin Elizabeth Holmes war Gründerin und Chefin dieses berühmten Biotech-Startups, das in der Spitze eine Bewertung von gegen USD 10 Milliarden erreichte. Ihre geniale Geschäftsidee basierte darauf, den Patienten mit einem Piks in den Finger und einem Tropfen Blut schnell und kostengünstig auf alle möglichen Krankheiten hin analysieren zu lassen. Elizabeth Holmes gelang es, eine Elite von potenten Investoren um sich zu scharen, zu denen zum Beispiel der Medienmogul Rupert Murdoch und der Gründer von Oracle, Larry Ellison, gehören. Der frühere amerikanische Aussenminister Henry Kissinger sass im Verwaltungsrat von Theranos. Dumm nur: Es stellte sich heraus, dass das ganze Geschäftsmodell auf Betrug basierte. Elizabeth Holmes wurde jüngst zu einer 11-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
«Fake it till you make it.»
Aufgrund unserer Erfahrung, die bald vier Jahrzehnte umfasst, kommen wir bezüglich der Performance von Private Equity zu folgendem Schluss: Im Durchschnitt dürfte ihre jährliche Rendite vor Kosten um rund 1 bis 2 Prozentpunkte über derjenigen von kotierten Aktien liegen. Da die alles umfassenden Kosten von Private Equity aber gemäss dem Beratungsunternehmen PPCmetrics auf rund 6 Prozentpunkte veranschlagt werden, liegt die jährliche Performance nach Kosten um rund 3 bis 4 Prozent unterhalb jener von kotierten Aktien, bei denen die Gesamtkosten in der Regel 1 Prozent nicht übersteigen. Aus diesen Gründen lassen wir von Private Equity, aber auch von allen anderen Formen Alternativer Anlagen, konsequent die Finger.
«Private-Equity-Anlagen sind wie eine Fata Morgana.»
Die Finger lassen wir weiterhin auch von Bankaktien, nachdem wir uns schon vor Jahren von ihnen verabschiedet haben. Wir haben das nie bereut. Das zeigt ein Blick auf die historischen Renditen dieser Branche. So hat der Index europäischer Bankaktien (Stoxx Europe 600 Banks) in den fünf Jahren von 2018 bis 2022 eine kumulierte EUR-Rendite von –6,1 Prozent (minus!) abgeworfen, während der Gesamtmarkt (ex Banken) eine kumulierte Rendite von 33,9 Prozent erreichte. Über die Langfristperiode von 15 Jahren (2008 bis 2022) sieht es noch schlechter aus. Bankaktien brachten es auf eine kumulierte Rendite von –40,6 Prozent (minus!), während der Gesamtmarkt (ex Banken) eine Rendite von kumuliert 131,1 Prozent erreichte. Mit Bankaktien schmilzt das Geld der Anlegerinnen und Anleger offenbar wie Schnee an der Sonne. Verzocken lässt sich das Geld aber auch, indem die falschen Finanzbücher gelesen werden. Marc Friedrich gilt in Deutschland in weiten Kreisen als Bestsellerautor und Starreferent. In der «Weltwoche» Nr. 50/2022 wurde er gefragt, was Anleger mit 10'000 Franken denn am besten tun sollten. Friedrich rät den Anlegerinnen und Anlegern, je einen Drittel in Gold, Silber und Bitcoin anzulegen. Nicht nur der Rat dieses «Experten» ist der nackte Wahnsinn, sondern ebenso die Tatsache, dass dieser Mist auch noch veröffentlicht wird.
«Fernsehen bildet. Immer, wenn der Fernseher an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese.»
Für die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten wird spannend sein zu verfolgen, wie sich die führenden Notenbanken der Welt im kommenden Halbjahr verhalten werden. Die durch die Decke geschossenen Inflationsraten in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie Europa sind zwar auf dem Rückzug, aber verharren nach wie vor auf hohem Niveau. Die Notenbanken befinden sich im Spannungsfeld zwischen Inflationsbekämpfung und Rezessionsgefahr. Das erste Szenario spricht für höhere, das zweite für tiefere Leitzinsen. Dazu gesellt sich der anhaltende Krieg in der Ukraine und eine fragile Bankenbranche, die in Teilen von den markant gestiegenen Zinsen auf dem falschen Fuss erwischt wurde. Das amerikanische Fed hat am 3. Mai den Leitzins zum zehnten Mal innerhalb von 14 Monaten auf 5,25 Prozent erhöht. In der Tendenz ist davon auszugehen, dass die Notenbank einen Marschhalt einlegen wird und spätestens im kommenden Jahr Zinssenkungen ins Auge fassen könnte, um die Konjunktur, die Bankindustrie und das Staatsbudget zu entlasten, auch wenn das Inflationsziel von 2 Prozent noch nicht erreicht sein sollte. Die Europäische Zentralbank und auch die Schweizerische Nationalbank werden mit zeitlicher Verzögerung ähnlich reagieren. Es gibt somit Anzeichen, dass der Peak der Inflations- und Zinsentwicklung bald hinter uns liegt, doch das Ziel der Notenbanker ist noch längst nicht erreicht.
«Ich glaube nicht, dass irgendjemand weiss, ob wir eine Rezession haben werden.»
Vielerorts ist zu lesen und hören, die Attraktivität von festverzinslichen Anleihen im Vergleich zu Aktien hätte nach dem markanten Zinsanstieg zugenommen. Dies ist ein Trugschluss. Zwar ist die Verzinsung von Anleihen sowohl in Amerika, in Europa und auch in der Schweiz massiv angestiegen. So hat sich die jährliche Rendite von 10-jährigen schweizerischen Bundesanleihen, die im August 2019 mit –1,2 Prozent ihren Tiefpunkt erreichte, in den vergangenen Monaten auf über 1 Prozent erhöht. Doch aufgepasst: Die um 2 bis 2,5 Prozent höhere Rendite geht einher mit einer noch stärker erhöhten Teuerung. So lag die Inflation in der Schweiz bis und mit Pandemie lange im Bereich von –1 Prozent, während sie zwischenzeitlich die Marke von 3 Prozent erreicht hat. Unter inflationsadjustierter Betrachtung hat somit die Attraktivität von Anleihen nicht zu-, sondern sogar abgenommen. Zu diesem Schluss kommt erst recht, wer berücksichtigt, dass die durch die Zinswende ausgelöste Börsenkorrektur auch das Bewertungsniveau der Aktienmärkte attraktiver werden liess.
«Die Geschichte lehrt uns, dass die Aktienmärkte oft schon vor einer Rezession zu steigen beginnen, weil sie die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Abschwungs bereits eingepreist haben.»
Da der Zinsendienst in den USA und in Europa seit der Zinswende regelrecht explodiert ist, wird die Schicksalsgemeinschaft aus Staaten und Notenbanken ein Interesse haben, die Zinsen unterhalb der Teuerung einzupendeln, was nichts anderes als eine Fortführung der finanziellen Repression bedeutet. Wer längerfristig Geld auf dem Konto hat oder in Anleihen steckt, wird auf realer respektive teuerungsbereinigter Basis sukzessive ausgeblutet. Investorinnen und Investoren, die ihr Geld langfristig auf realer Basis erhalten oder noch lieber vermehren wollen, sind dazu «verdammt», Risiken einzugehen. Sie kommen nicht darum herum, einen gewichtigen Teil ihres Vermögens in langfristig attraktive Aktien oder auch in Immobilien anzulegen – wobei im Falle der Immobilien aus verschiedenen «Hot Spots» Warnsignale einer Preisblase zu hören sind. Anzeichen einer Abkühlung sind erkennbar. Gemäss dem Beratungsunternehmen Fahrländer Partner sind die Marktpreise von schweizerischen Mehrfamilienhäusern alleine im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr um über 12 Prozent gefallen. Immobilienexperten von Wüst Partner schätzen den Marktwert aller Mehrfamilienhäuser in der Schweiz auf rund CHF 2'400 Milliarden. Daraus ergibt sich, dass sich alleine in diesem Segment etwa CHF 290 Milliarden in Luft aufgelöst haben – mit den entsprechenden Folgen für Pensionskassen und Versicherungen, die in der Tiefzinsphase kräftig in «Betongold» investiert haben. Offenbar geht der Zinsanstieg auch an den Preisen von Immobilien nicht spurlos vorbei. Für den europäischen Raum warnt die Europäische Zentralbank gar vor einer «ungeordneten Korrektur» der Immobilienpreise. Im Vergleich zu Aktien erfolgt die Preiskorrektur in diesem Segment erfahrungsgemäss mit Verzögerung, weil der Markt viel weniger liquide ist. Neben Aktien und Immobilien brauchen viele Anlegerinnen und Anleger trotz allem auch Festverzinsliche. Qualitativ herausragende Anleihen sind und bleiben nämlich die beste und sicherste Anlage, um für den Lebensunterhalt oder für kurz- bis mittelfristig geplante Investitionen zu dienen.
«Der Immobilienmarkt kippt»
Die letzten Monate waren an den Kapitalmärkten herausfordernd. In diesem holprigen Umfeld hat sich unsere vorsichtige Anlagepolitik in besonderem Masse bewährt. Dies wird nicht zuletzt durch unsere überragenden Performance-Ergebnisse bestätigt, die in den vergangenen 18 Monaten weit über den Markt- und Konkurrenzverhältnissen liegen. Es wird Sie deshalb nicht wundern, wenn wir Ihnen in diesem Schreiben erneut bekräftigen, an unserer qualitätsorientierten und wertkonservativen Politik, unserem Fokus auf erstklassige Substanz- und Dividendenpapiere sowie an sicheren Anleihen festzuhalten.
«Es gibt keine einzige Studie weltweit, die eine dauerhafte Leistungssteigerung durch Bonussysteme nachgewiesen hätte. Lediglich bei hochrepetitiven Arbeiten (Säckeschleppen) lassen sich kurzfristig leistungssteigernde Effekte nachweisen.»
In eigener Sache noch dies: Über 200 Kundenportfolios, die wir betreuen dürfen, liegen bei der Credit Suisse. Die Wochen und Monate vor dem bedauerlichen Untergang dieser Traditionsbank waren auch für uns eine Herausforderung. Wohlwissend, dass die in Aktien und Anleihen angelegten Vermögen unserer Kundinnen und Kunden als Sondervermögen geschützt sind und damit nie im Risiko standen und stehen, fielen die auf den Konti liegenden Gelder, die den staatlich geschützten Betrag von CHF 100'000 übersteigen, bei einer Insolvenz der Bank in die Konkursmasse. Da im Monat März jeweils Hochsaison der Dividendenzahlungen herrscht und somit signifikant Liquidität zufliesst, war unser Portfoliomanagement in den Tagen und Wochen vor dem Untergang der Bank täglich und teilweise sogar stündlich damit beschäftigt, den Saldo der CS-Kundenkonti im Auge zu behalten, um ihn möglichst unter der geschützten Grenze von CHF 100'000 zu halten. Mit dieser rigorosen Liquiditätskontrolle waren unsere Kundinnen und Kunden mit Depotbank Credit Suisse stets auf der sicheren Seite. Die am 19. März vom Bundesrat per Notrecht verordnete Übernahme der Credit Suisse durch ihre Rivalin UBS war mit unserer Brille als Vermögensverwalter sodann eine Erleichterung. Betrachten wir die Lösung jedoch mit der Brille eines Bürgers und Steuerzahlers, als die wir für das Versagen der Banker potenziell geradestehen müssen, ist unsere Stimmung definitiv eine andere. Die erneute Rettung einer Grossbank durch den Staat ist ordnungspolitisch eine Schande für die Schweiz.
Obwohl sich der Untergang der Credit Suisse nach unserer Beurteilung bereits gegen Ende 2022 abzuzeichnen begann, stellte für uns der Transfer aller Kundenportfolios zu anderen Depotbanken keine Alternative dar. Im Gegenteil: Wir hätten möglicherweise sogar ein Chaos riskiert, da einerseits die Credit Suisse mit der Abwicklung so vieler Wertschriftenportfolios vollkommen überfordert gewesen wäre (in den entsprechenden Abteilungen wurde zeitweise nicht einmal mehr das Telefon bedient), und andererseits auch die neuen Depotbanken nicht in der Lage gewesen wären, die Neueröffnungen innerhalb nützlicher Frist zu erfassen – es sind nämlich geradezu administrative Bürokratiemonster von Dokumentenstössen, die abgearbeitet werden müssen, um in der heutigen Zeit eine Kundenbeziehung zu eröffnen.
«Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.»
Wie wir Ihnen in einem früheren Kundenschreiben bereits anvisiert haben, verpflichten uns das neue schweizerische Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) sowie das Finanzinstitutsgesetz (FINIG), der Regulierungsbehörde FINMA unterstellt zu sein – ähnlich wie die Banken. Dies primär deshalb, weil wir neben umfangreichen privaten auch grosse Vermögen von Pensionskassen verwalten dürfen. Nach intensiver, teilweise ausufernder und bürokratischer Aufarbeitung unzähliger Reglemente und Paragraphen haben wir planmässig in diesem Frühjahr die Bewilligung der FINMA erhalten. Freuen wir uns darüber? Ja. Sind wir stolz auf diese Lizenz? Nein. Uns und unseren Kundinnen und Kunden bringt die Regulierung durch die schweizerische Aufsichtsbehörde nichts – abgesehen von einem Monsteraufwand für Risikoaufklärungen, Risikochecks, Gesprächsaufzeichnungen und Reglementsauf- sowie Überarbeitungen. Ein Blick auf die Verfehlungen, Gerichtsfälle und Bussenzahlungen im Zusammenhang mit Geldwäscherei oder betrügerischen Manipulationen in der Welt der Banken, die seit Jahr und Tag von der FINMA reguliert werden, genügt um festzustellen, dass eine noch so strikte Regulierung herzlich wenig bewirkt. So haben in den Jahren 2010 bis 2022 alleine die CS knapp CHF 17 Milliarden und die UBS gut CHF 12 Milliarden für Rechtsfälle aufgewendet. Und die Finanzmarktaufsicht FINMA hat jüngst bekanntgegeben, dass im Zusammenhang mit einem ehemaligen Gouverneur der Zentralbank Libanons ein Geldwäschereiverdacht gegen 12 (!) Schweizer Banken bestehe – die von der Schweizerischen Bankiervereinigung schon vor vielen Jahren ausgerufene Weissgeldstrategie sieht anders aus. Wir können es nicht genug betonen: Anstand und Moral lassen sich nicht staatlich verordnen respektive regulieren. Sie sind eine Frage des Charakters.
«Die Leitwährung des demokratischen Systems ist Vertrauen.»
Transparenz und Ehrlichkeit sind auch bezüglich des gelebten Geschäftsmodells und im Umgang mit den gegenüber Kundinnen und Kunden vereinnahmten Gebühren gefordert. Wie uns Experten bestätigen, ist es auf dem schweizerischen Finanzplatz nach wie vor Usanz, Retrozessionen respektive Kick-Backs auf Börsentransaktionen, Depotgebühren und Anlageprodukten aller Art zu kassieren. Das ist nicht nur unanständig, sondern gelinde gesagt eine Sauerei. Unsere gelebte Unabhängigkeit ist Garantin dafür, dass wir konsequent die Interessen unserer Kundinnen und Kunden wahrnehmen und einzig und alleine von deren Honorar leben. Leider interessieren solche und ähnliche Fragen und Überlegungen den Regulator genauso wenig wie die Frage, ob die Bank oder der Vermögensverwalter eine anständige und ehrenhafte Klientel betreut oder eher eine «schräge». Hauptsache, die Formalitäten stimmen, Listen wurden abgearbeitet und die Kreuzchen am richtigen Ort gemacht. Die Aufsichtsbehörde FINMA ist im Zusammenhang mit dem Untergang der Credit Suisse erheblich unter Beschuss geraten. Es ist zu hoffen, dass die Behörde in Zukunft weniger, aber die richtigen Fragen stellt.
«Wenn ich selber als Anleger einen Vermögensverwalter suchen würde, und ich dürfte ihm bei der Evaluation nur eine einzige Frage stellen, dann wäre es diese: Gibt es neben dem direkten Honorar, das ich Ihnen bezahle, noch andere Gelder, die Sie im Kontext meines Mandates vereinnahmen – beispielsweise Retrozessionen auf Börsentransaktionen und Depotgebühren, Retrozessionen auf fremde Produkte, Finder-Fees oder indirekte Gebühren auf eigenen Fonds und strukturierten Produkten? Wenn die Bank oder der Vermögensverwalter diese Frage nicht klar mit einem Nein beantworten kann, deutet dies darauf hin, dass das Institut nicht unabhängig ist und dass Interessenkonflikte bestehen, die dem Kunden schaden. Leider müssen wohl gegen 99 Prozent der Finanzmarktakteure diese Frage mit Ja beantworten. Selbst wenn sie keine Retrozessionen kassieren, verdienen sie in der Regel zumindest bei eigenen Produkten.»
Liebe Kundinnen und Kunden, wir freuen uns auf die weitere, fruchtbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für Ihr geschätztes Vertrauen bedanken wir uns bei Ihnen sehr herzlich. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben schöne Sommerwochen und vor allem beste Gesundheit!
Mit herzlichen Grüssen, im Namen des ganzen «Hotz-Teams», Ihr
Dr. Pirmin Hotz